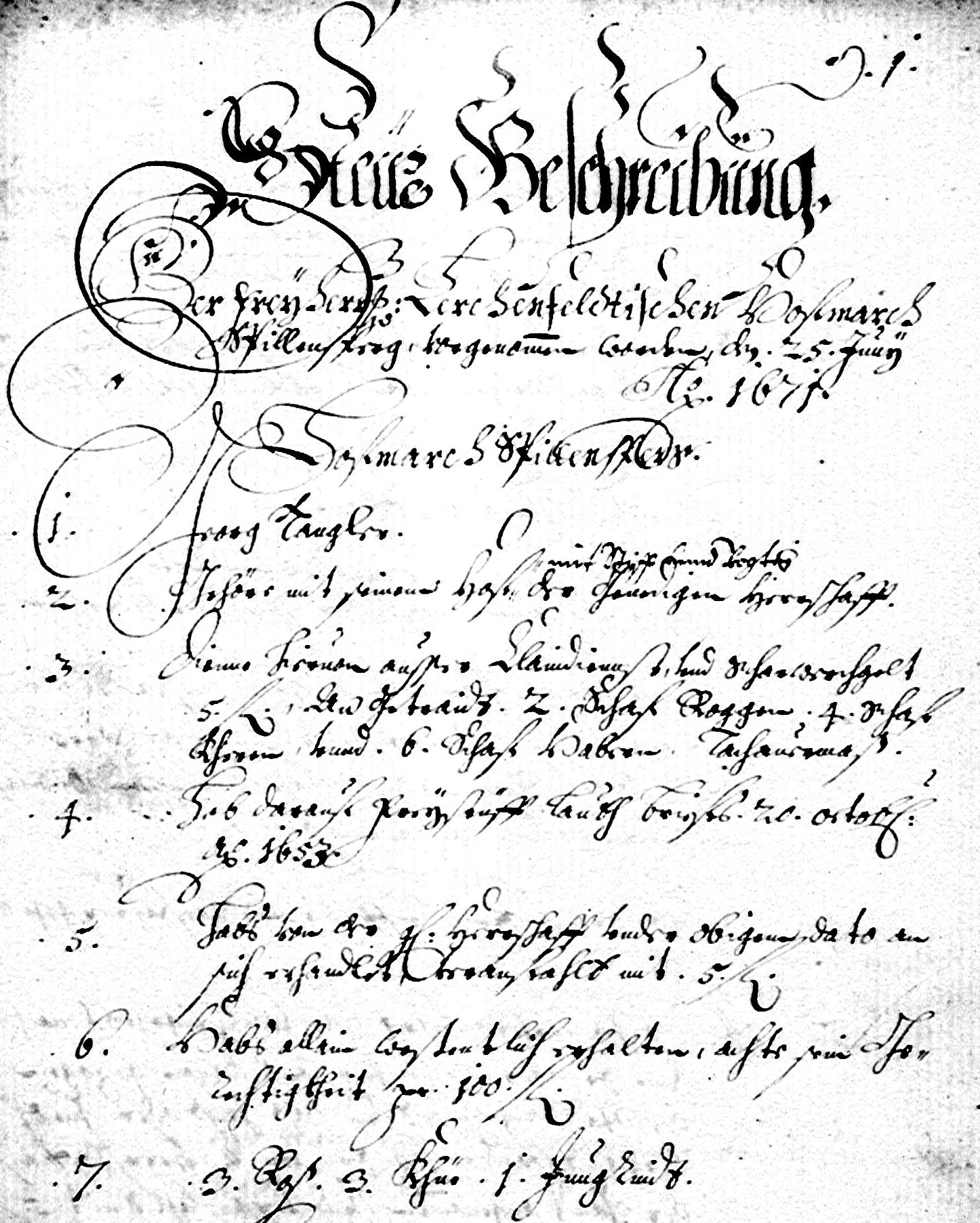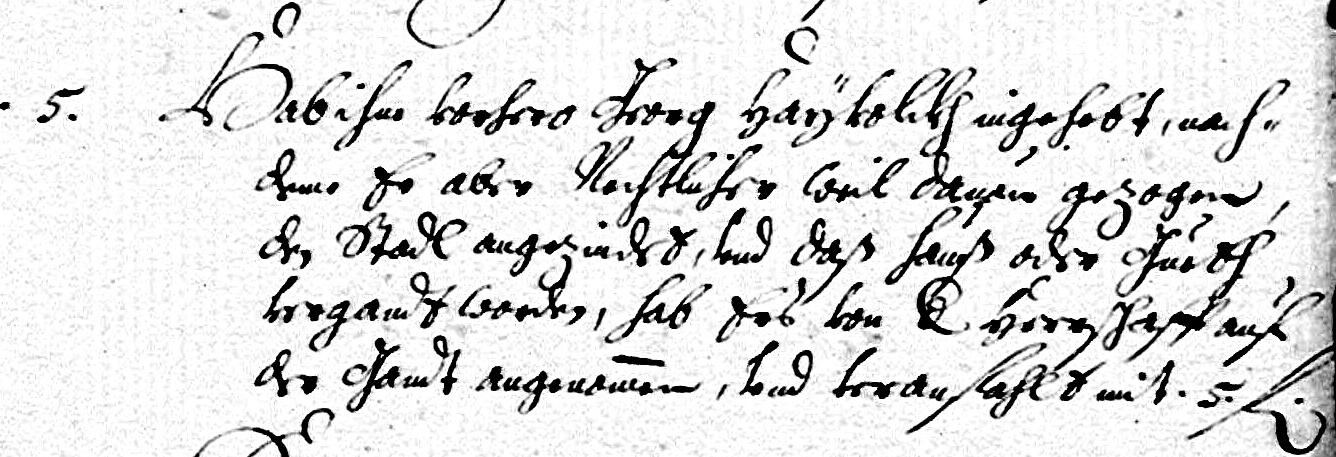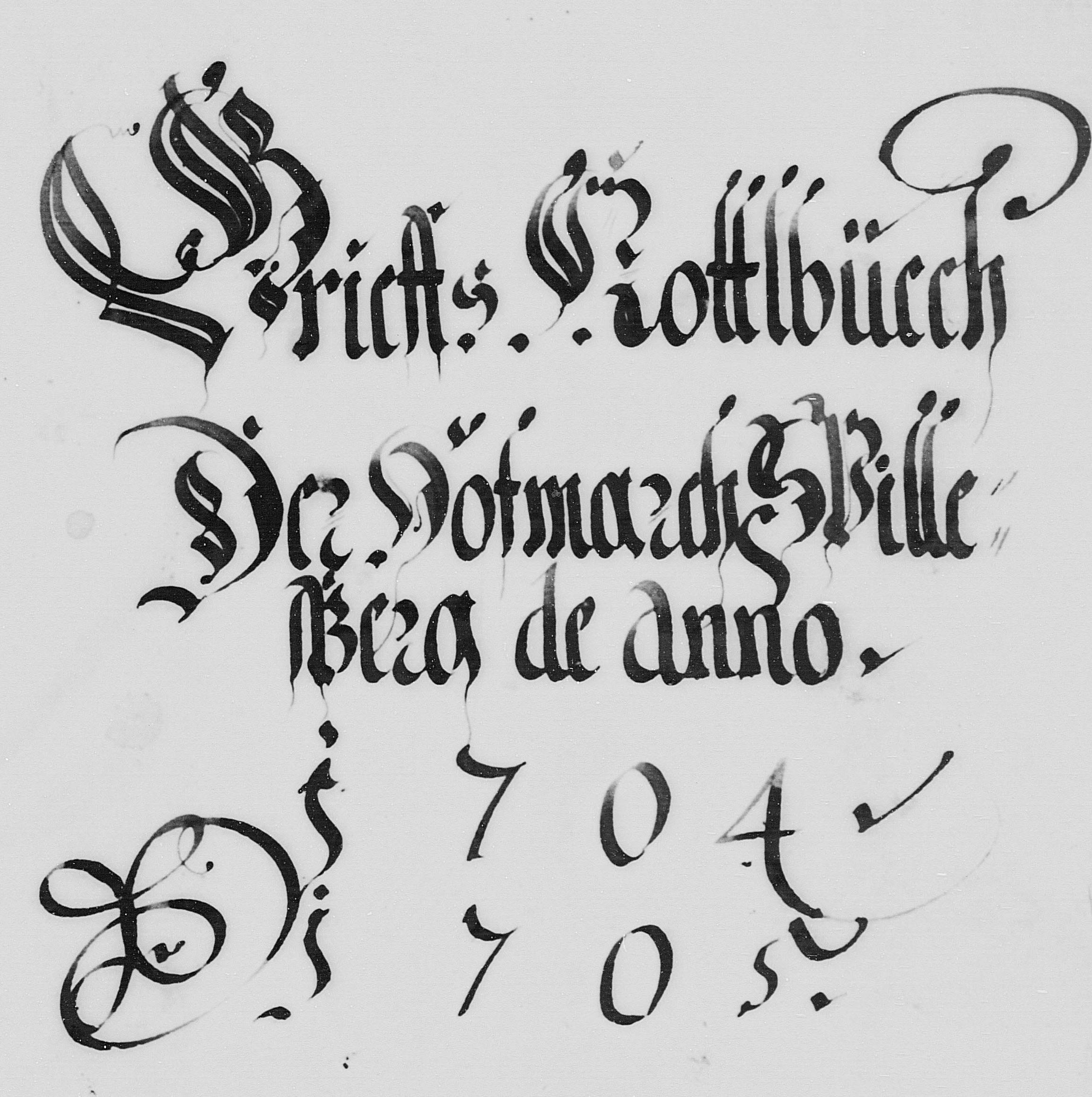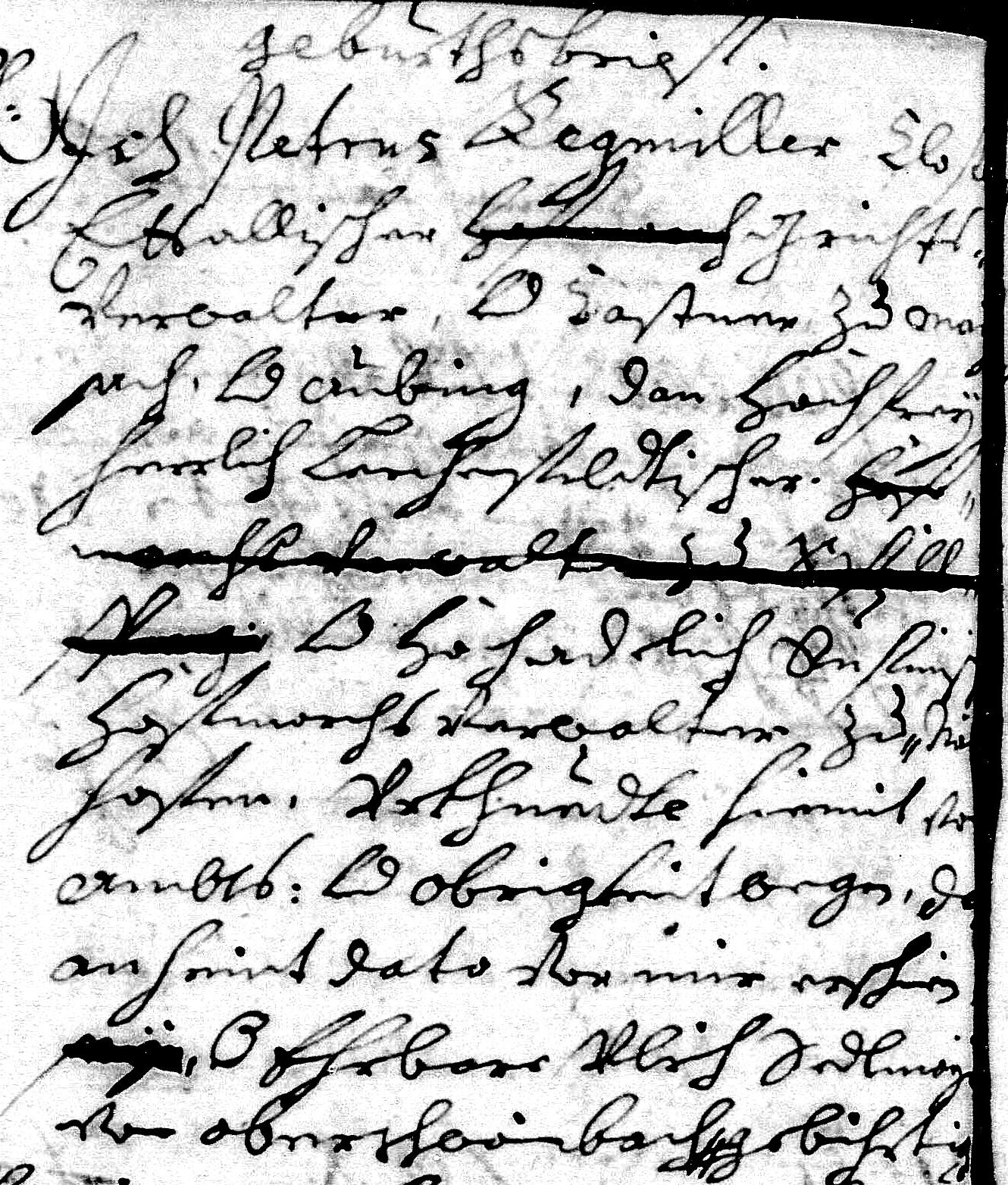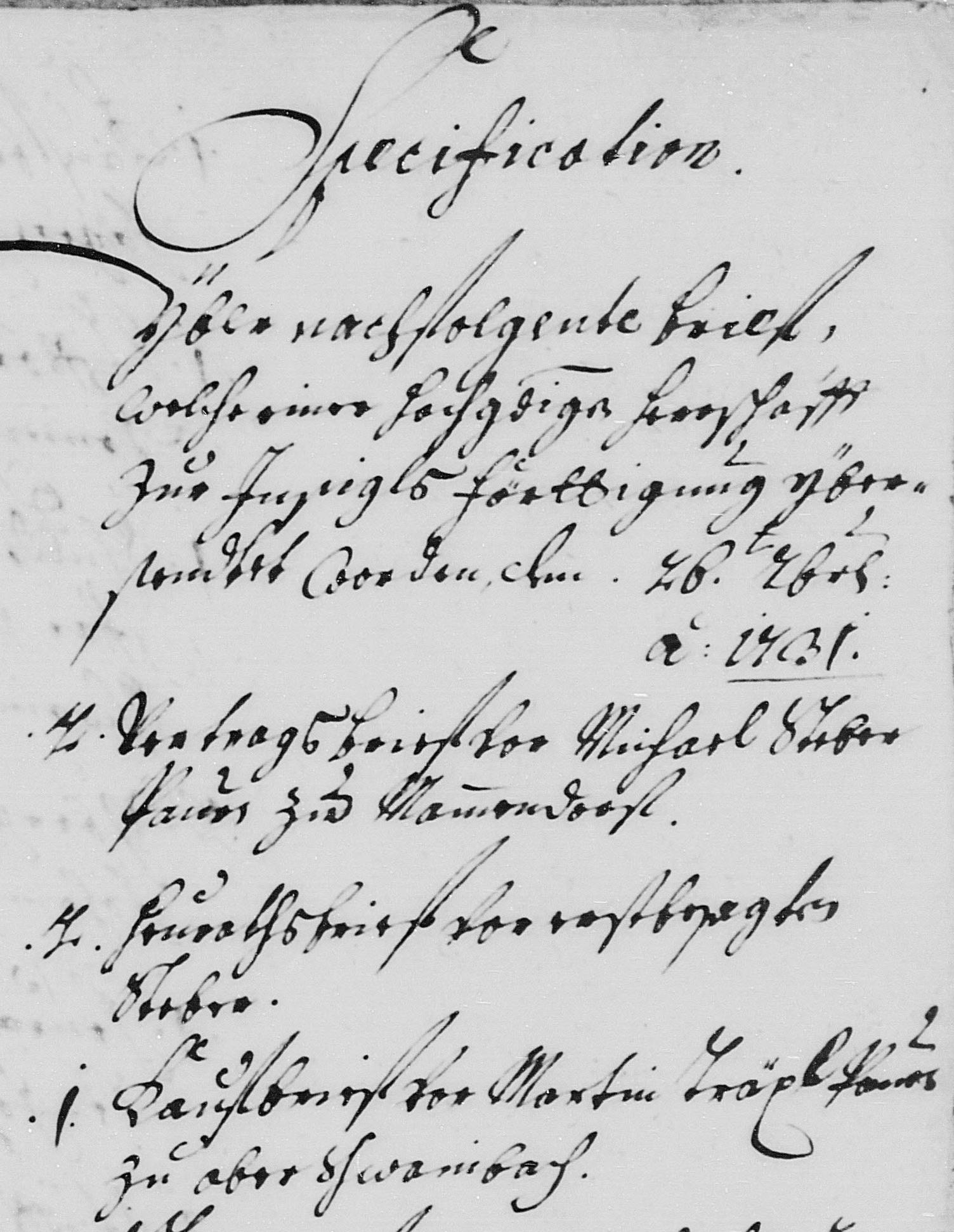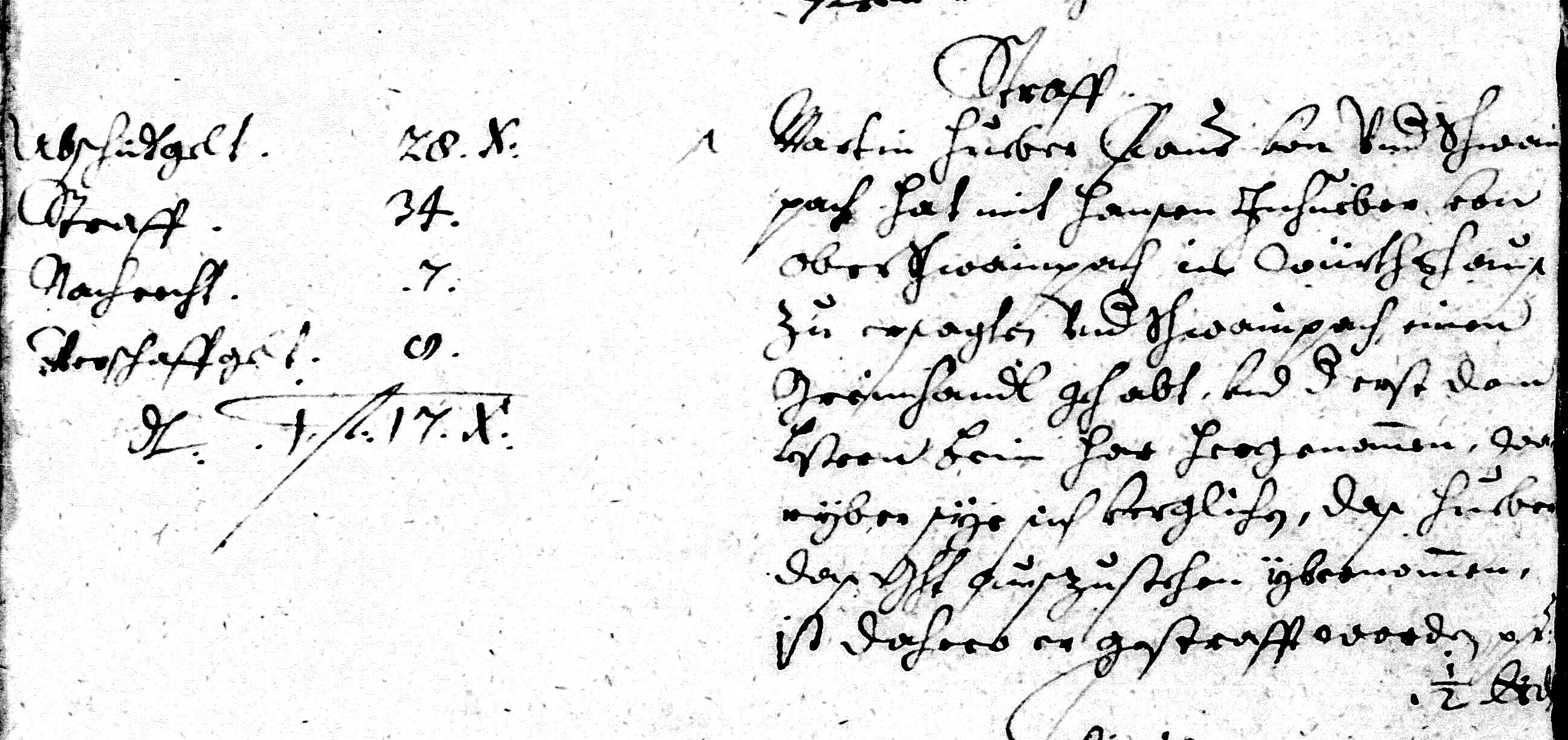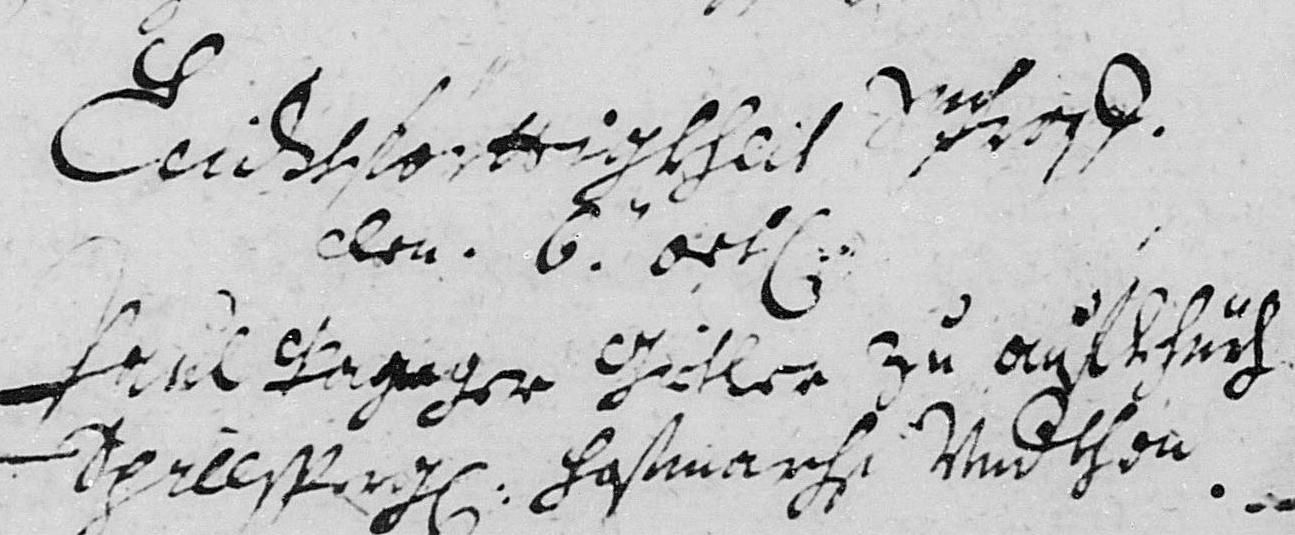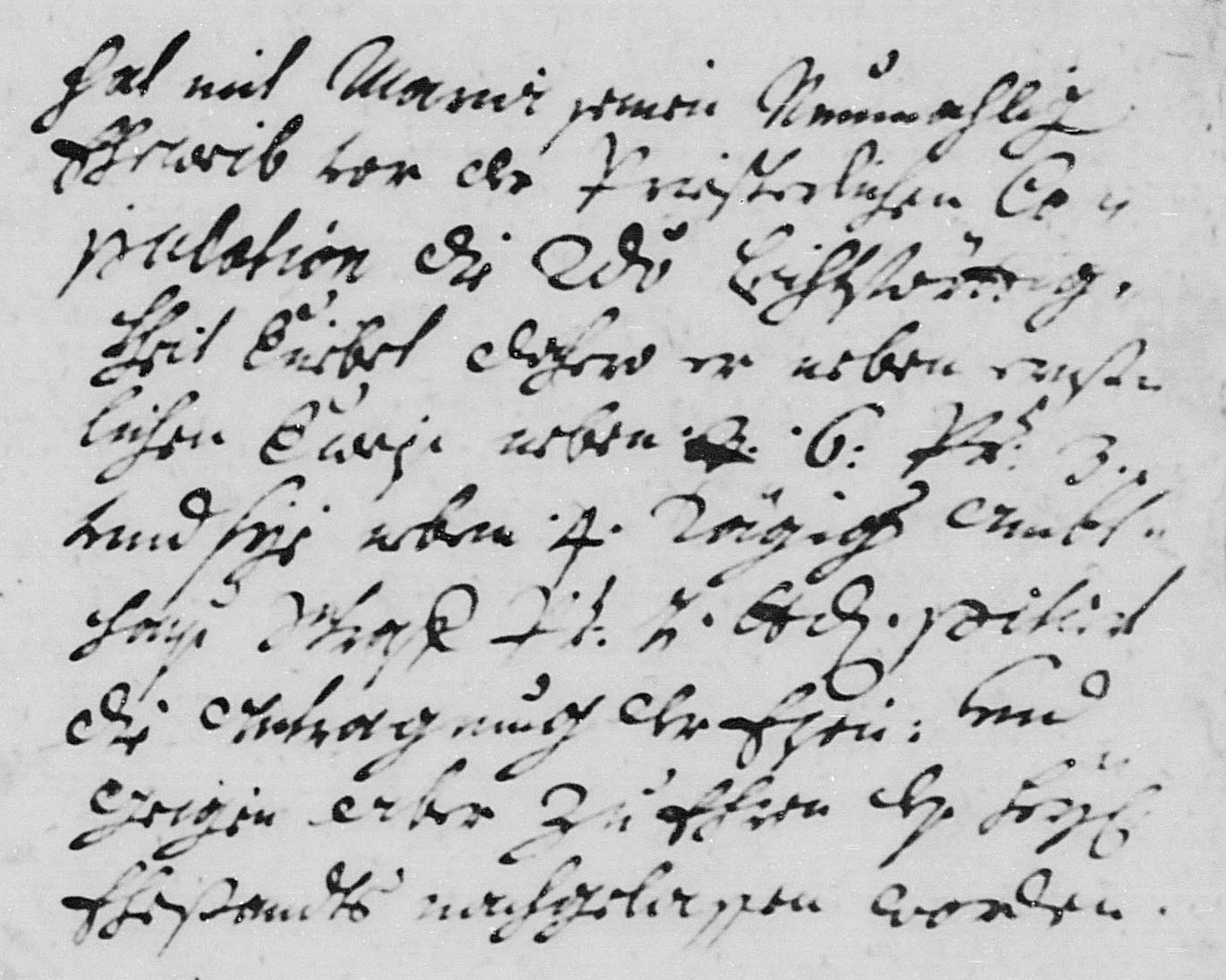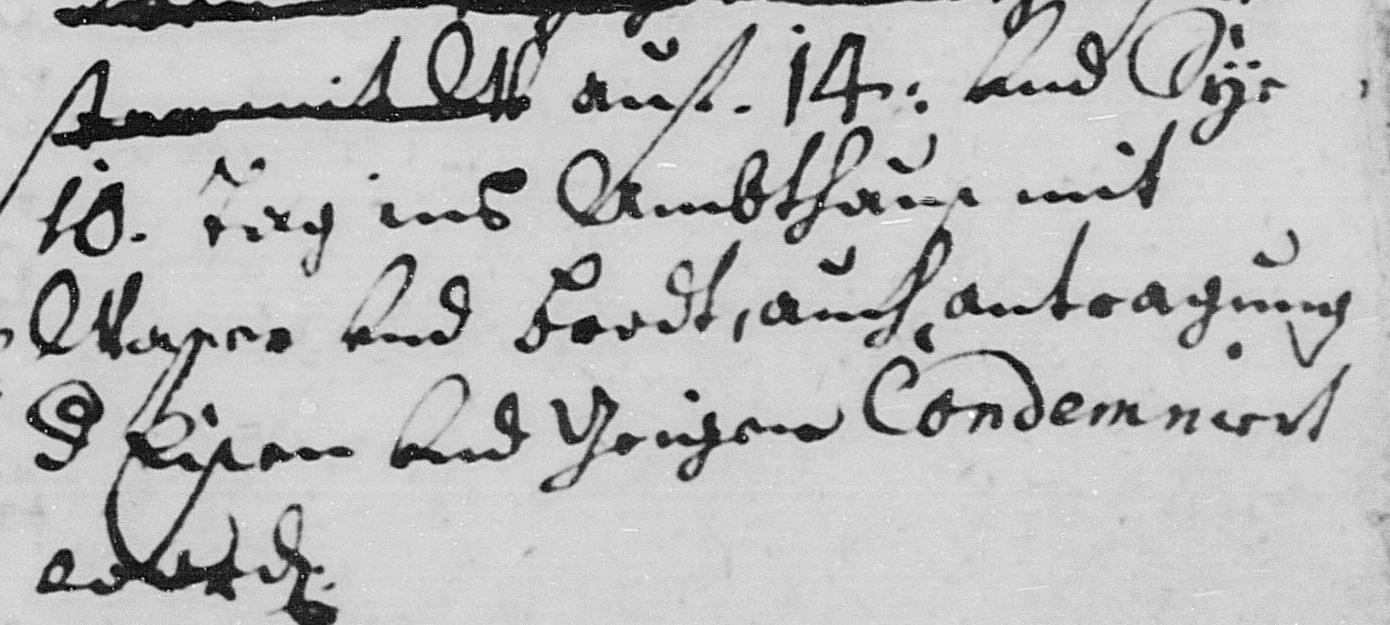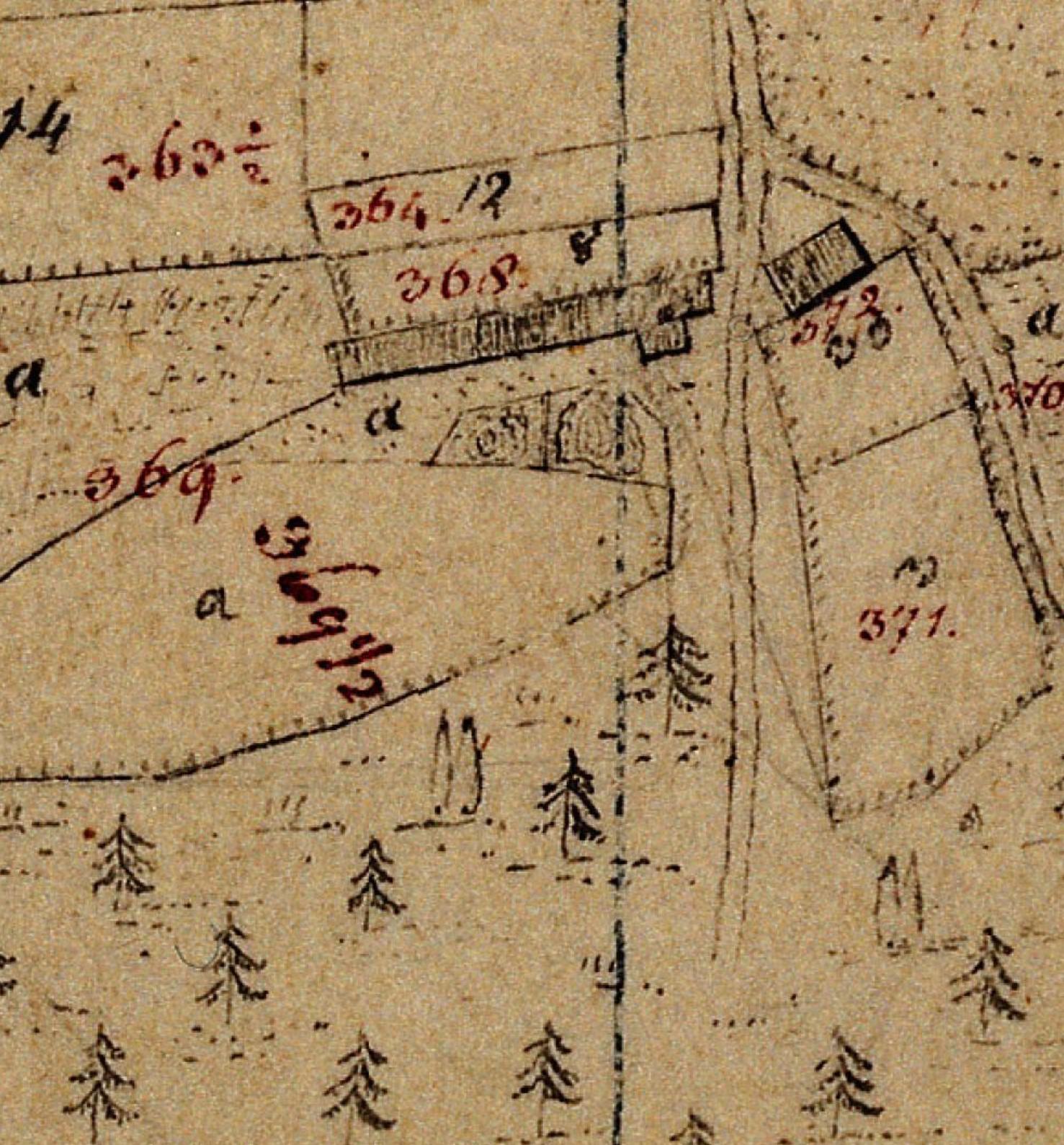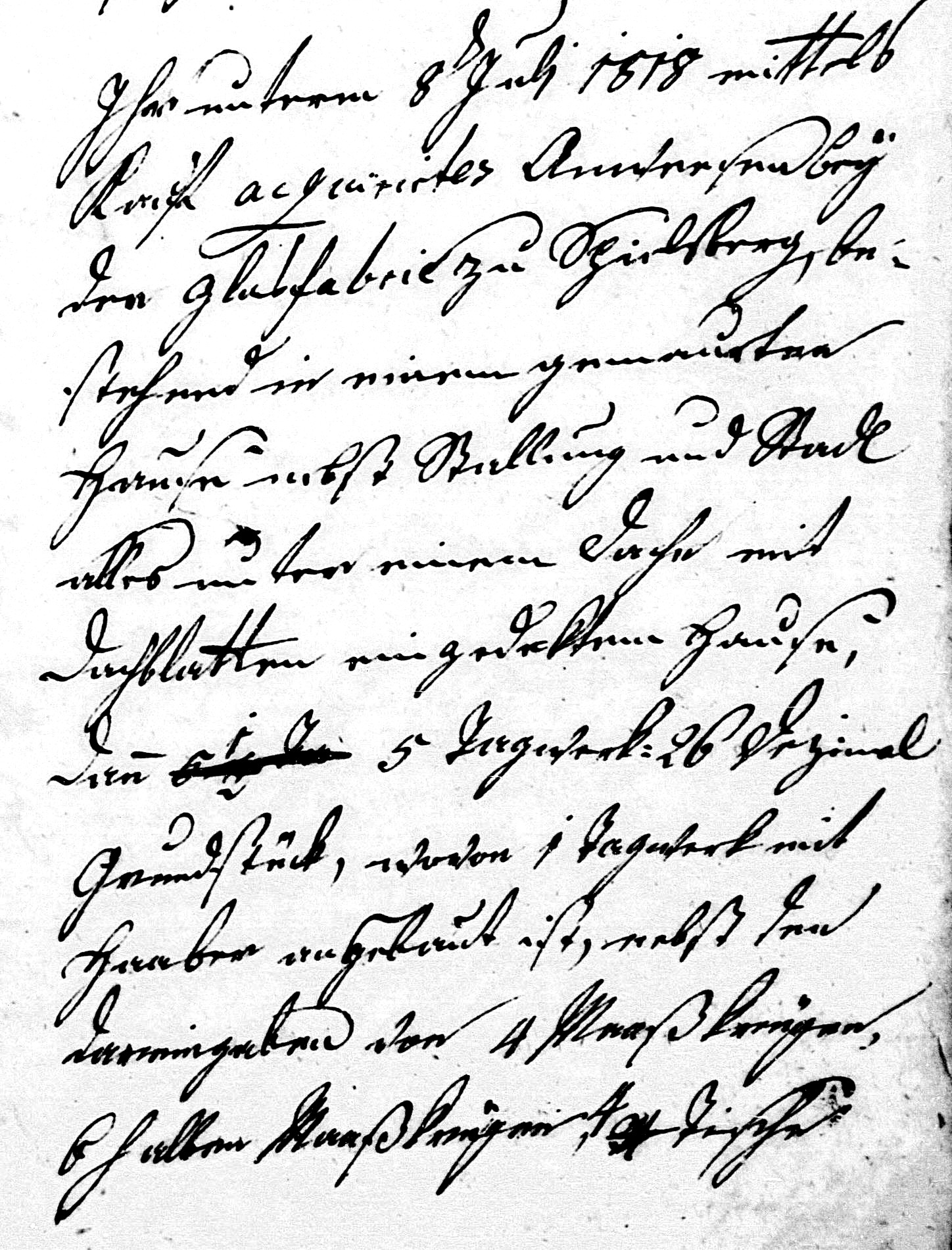Hofmark Spielberg
Vorwort
Um eine Ortsgeschichte zu schreiben, braucht man Information. Die
eigene Erinnerungen reichen nicht weit zurück. Frühere Bewohner
haben nichts aufgeschrieben. Sie konnten nicht schreiben, denn
erst ab 1800 lernten die Kinder lesen und schreiben, damit sie
wenigstens ihren Namen schreiben konnten. Aufgeschrieben hat der
Pfarrer, wem er die Sakramente gespendet hat, Taufen, Heiraten,
Beerdigungen. Dazu war er durch sein Amt verpflichtet und die
Vorgesetzten haben es kontrolliert. Der Häuserbuch-Teil der
Ortschronik enthält deshalb Namen, Geburtsdaten, Heiratsdatum und
unvollständig die Sterbedaten. Das haben wir aus den
Taufbüchern, Heiratsbüchern und Sterbebüchern zusammen
gesucht. Doch Namen und Datum alleine sagen wenig über die
Lebensumstände. Wer hat sonst noch etwas aufgeschrieben, was heute
noch erhalten ist? Es waren die Beamten, die Steuern einkassieren
mussten, denn sie hatten ihren Vorgesetzten Rechenschaft
abzulegen. Der Staat kassiert nicht nur Steuern, er gibt seinen
Bürgern auch Sicherheit und garantiert das Eigentum, vor allem das
Grundeigentum. Heute heißt das Grundbuch. Im folgenden geht
es immer um Steuern und Behörden. Richtig gelesen verraten
die Akten eine Menge über das frühere Leben, obwohl das nicht die
Absicht der damaligen Schreiber war.
Der Hoffuß
Zum Verständnis muss vorweg der Hoffuß erklärt werden. Das sind die
Bruchzahlen, die immer wieder im Zusammenhang mit Häusern genannt
werden. Der Hoffuß ist der Steuersatz.
1/1 war der Ganzbauer, ein Vollerwerbslandwirt mit 100 Tagwerk
Grund und 4 bis 6 Pferden.
1/2 war der Halbbauer, auch Landwirt, aber mit einem halb so großen
Hof.
1/4 war ein "Gütler", Nebenerwerbs-Landwirt, wenig Grund, meist mit
einem Gewerbe, zB. Wagner
1/8 war eine "Sölde", meist ein Handwerker mit etwas Landwirtschaft,
etwa der Müller
1/16 war der Häusler, ohne Ackerbau, er lebt von seinem Beruf oder
ist Taglöhner.
1/32 hatte nur eine Haushälfte oder andere Unterkunft.
Die Steuer, das war die heutige Grundsteuer, wurde mit dem Hoffuß
berechnet. Der Ganzbauer zahlte den vollen Steuersatz, die anderen
nur einen Bruchteil davon. An der alten Bausubstanz in den Dörfern
kann man diese Einstufung heute noch gut erkennen, denn die Größe
der Gebäude folgte dieser Abstufung. Das Ansehen in der
Dorfgemeinschaft, die soziale Einstufung, folgte genau dem
Hoffuß.
Entstehung der Hofmark
Auf unserem guten Ackerboden wurde schon immer Getreide
angebaut. Als die römische Herrschaft durch die
Völkerwanderung verfiel, kamen unsichere Zeiten für die Bauern. An
günstigen Stellen wurden Burgen gebaut, in denen sich die Bauern
bei Gefahr mit ihrem Vieh in Sicherheit bringen konnten. In
Flurnamen wie Schloßberg, Burgstall u.a. steckt noch die
Erinnerung an diese Burgen. Die Burgherren lebten von den Abgaben
der Bauern. Als die Wittelsbacher Herzöge ihre Herrschaft über
Bayern etablierten, wurden aus den ritterlichen adeligen
Burgherren Beamte oder Militärs im Gefolge der Wittelsbacher.
Ihren kleinen Herrschaftsbereich über das Dorf, genannt
Hofmark behielten sie. Manche wohnten mit der Familie weiter
in einem Schloß oder Burg im Ort. Allerdings waren diese Gebäude,
selbst die anspruchsvollen Barockschlösschen, nicht beheizbar und
damit im Winter unbewohnbar. Nach dem Ende der herbstlichen
Jagdsaison ist die adelige Familie bis Ostern in
die Stadt gezogen.
In Spielberg waren die Barone Lerchenfeld und in Günzlhofen
Barone Imhof Jahrhunderte lang die Herrschaft. Man
muss sich diese Familien als weit verzweigte Klans vorstellen.
Dabei sieht man immer nur die Männer. Über die Frauen
und die Töchter, waren die Adelsfamilien praktisch alle
verwandt, nicht nur in Bayern, sondern europaweit.
Die Imhof gehörten zum Augsburger Patriziat und hatten ihren
Wirkungskreis überwiegend in Schwaben, das damals noch nicht
bayerisch war.
Die Lerchenfeld saßen eher in der Reichsstadt Regensburg und
hatten den Stammsitz in Unterbrennberg im Landkreis Regensburg,
nördlich der Donau.
Da es hier um Oberschweinbach geht, soll dies nur erklären, warum
diese Adeligen zwar die Herren unserer Orte waren, selbst aber nie
hier aufgetaucht sind, sondern nur die Steuern aus dem Ort
kassiert haben.
Die Abwesenheit der Herrschaft hatte auch Vorteile. Von den
Untertanen wurden keine Scharwerksleistungen gefordert. So nannte
man Einsatz der Dorfbevölkerung für Arbeiten in der
Landwirtschaft des Schlosses, beim Wegebau oder als Treiber bei der
Jagd des Schlossherrn. Für Ärger sorgte meist der Ernte-Einsatz,
wenn die Bauern die eigene Ernte verderben sahen, weil sie die Ernte
des Herrn einbringen mussten. Dieser Vorteil war jedoch nicht
umsonst. Schon im Steuerbuch 1671 heißt es beim Bauern Georg Tangler
Scharwerkgeld 5 Gulden. Die Herrschaft kassierte Geld anstelle
von Arbeitsleistung. Selbst die armen Häusler mussten 2 oder 3
Gulden Scharwerksgeld zahlen. Das waren die einzigen Abgaben in
Geld. Die anderen Abgaben, entsprechend der heutigen Grundsteuer,
erfolgten in Naturalien: Kleindienst (Hühner, Eier und
Butter) und Getreide (Roggen und Hafer). Das war fast noch das
mittelalterliche Verhältnis von Herr und Untertan aus einer Zeit
ohne Geld-Wirtschaft.
Landgericht Dachau
Dass Oberschweinbach und Günlhofen bis 1848 Hofmarksorte waren,
ist Zufall. Andere Dörfer, wie Längenmoos unterstanden
direkt dem Landgericht Dachau. Das Pfleggericht Dachau reichte vom
Münchener Burgfrieden bis zur Glonn. Die Dörfer Schwabing,
Neuhausen und Sendling wurden in Dachau verwaltet. Die
Klosterhofmark Fürstenfeld war neben der Hofmark Indersdorf die
größte Hofmark im Gericht Dachau. Erst 1823 wurde das Landgericht
Fürstenfeldbruck gebildet.
In Längenmoos erinnert nur der Flurname "Schloßfeld" an
eine verschwundene frühmittelalterliche Herrschaft. Für Längenmoos
war das Amt Esting als Zweigstelle des Dachauer Landgerichtes
zuständig.
Andere Hofmarken im Vergleich
Es gibt in der Umgebung Hofmarksorte mit Schlössern, die wirklich
Wohnsitz der Adeligen waren Zum Beispiel Odelzhausen.
Dort hat die Herrschaft die Entwicklung der Orte beeinflusst,
indem sie qualifizierte Handwerker im Ort ansiedelte, die
auch Qualitätsansprüche der Adelsfamilie bedienen konnten,
wie die aufwendigen Garderoben der Barockzeit. Diese
Handwerker versorgten mehr als den örtlichen Markt und förderten
zugleich die Autarkie des Schloßbetriebes.
Großbetriebe wie Brauereien wurden gegründet mit den dazu
notwendigen Hopfengärten oder in Taxa ein Kloster als beliebter
Wallfahrtsort.
So blühte in diesen Hofmarken die Wirtschaft auf und die
Herrschaft erhöhte ihre Steuereinnahmen.
In Günzlhofen und Oberschweinbach gab es wegen der Abwesenheit der
Herrschaft keine solche Entwicklung. Wir blieben reine
Bauerndörfer mit wenigen für den bäuerlichen Eigenbedarf
erforderlichen Handwerkern.
Verwaltung der Hofmark, Archivalien zu Oberschweinbach
Die Behörden der Barockzeit hatten erstaunlich wenig Personal. In
der Hofmark gab es einen Richter, über dessen Person unten mehr
steht.
Der Schreiber war sein Angestellter und wurde vom Richter bezahlt
.
Im Ort gab es einen Polizisten, der im Amtshaus eine Dienstwohnung
hatte und für alles zuständig war, sogar für die Instandhaltung
des Amtsgebäudes. Für seine Arbeit brauchte er zwei Knechte und
zwei Pferde.
Alle Beamten bekamen kein Gehalt, sondern lebten von den Gebühren
für ihre Tätigkeit.
Die Verwaltung ist für die Ortsgeschichte interessant, denn sie
hat Akten hinterlassen, die bis heute im Staatsachiv erhalten sind
und die Quelle der vorliegenden Geschichte sind. Alles ist
mit diesen örtlichen Archivalien belegt und nicht aus
Fachbüchern abgeschrieben. Zum besseren
Verständnis wurde versucht, die Dokumente zu erklären. In den
Archivalien geht es nur um die Steuern, denn die Beamten schrieben
keine Literatur für spätere Heimatforscher, sondern
rechneten korrekt ihre Arbeit ab. Was jeder wusste, wurde
nicht aufgeschrieben. Es muss dem heutigen Leser erklärt werden.
Dreißigjähriger Krieg
Die Ortsgeschichte beginnt mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618
bis 1648), über den nur zu berichten ist, dass er für die
Landbevölkerung hier unvorstellbar grausam war. Bis 1632 hat
das bayerische mit dem kaiserlich österreichischen Heer
Norddeutschland verwüstet, doch 1632 haben die von den
Protestanten zu Hilfe gerufenen Schweden Bayern erreicht und alles
zerstört. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, ist
umgekommen. Bevor das Leben wieder normal war, kamen die
Schweden 1648 noch einmal und zerstörten noch einmal alles.
Von den vor 1650 vorhanden Archivalien, wie die Taufbücher,
Heiratsbücher und Sterbebücher der Pfarrei Günzlhofen, ist nichts
übrig geblieben. Da es auch keinen Pfarrer mehr im Ort gab,
beginnen die Eintragungen im Taufbuch spärlich im Jahr 1651.
Heiraten sind erst ab 1664 wieder normal registriert.
Der Neu-Aufbau der Dörfer war schwierig. Jeder der es sich
zugetraut hat, ein Haus oder einen Bauernhof aufzubauen, bekam
eine Chance dazu. Viele haben es nicht geschafft, denn
Vieh musste gekauft und neu gezüchtet werden. Die Felder
waren verbuscht und mussten gerodet werden. Bauholz für die Häuser
musste erst im Wald gefällt und zu Balken bearbeitet werden.
Bei den Neusiedlern wissen wir nicht, wo sie her gekommen sind.
Sie gelten als "Tiroler", denn viele kamen vom Alpenrand, der von
den Schweden nicht erreicht wurde.
Steuerbuch von 1671
1671 ordnete der Kurfürst eine Bestandsaufnahme für das ganze
Land an. Dieses "Steuerbuch von 1671" ist für Hofmark Spielberg
und Günzlhofen erhalten. Es nennt vier Bauern:
Als erster wagt Johann Bals den Aufbau. Er kaufte "vor 30 Jahren",
also 1641 die leere Hofstatt, Hofname Bals Kreisstraße 38
1649 heiratet Peter Huber die Tochter von Wolf Magg,
Kreisstraße 46
1653 kaufte Georg Tangler von der Herrschaft. Das wurde der
Schloßbauer.
,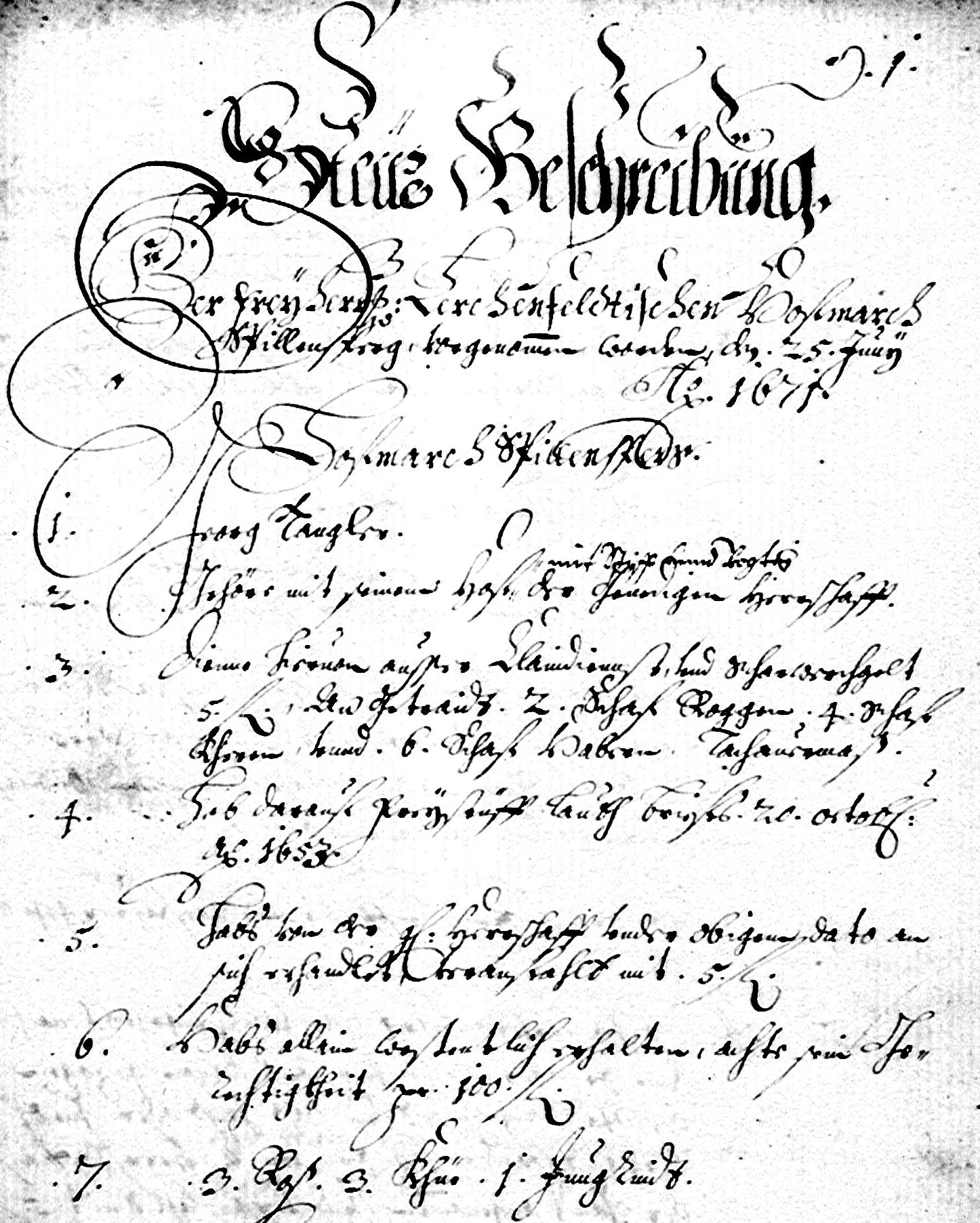
Nicht jeder hat den Aufbau eines Hofes geschafft:
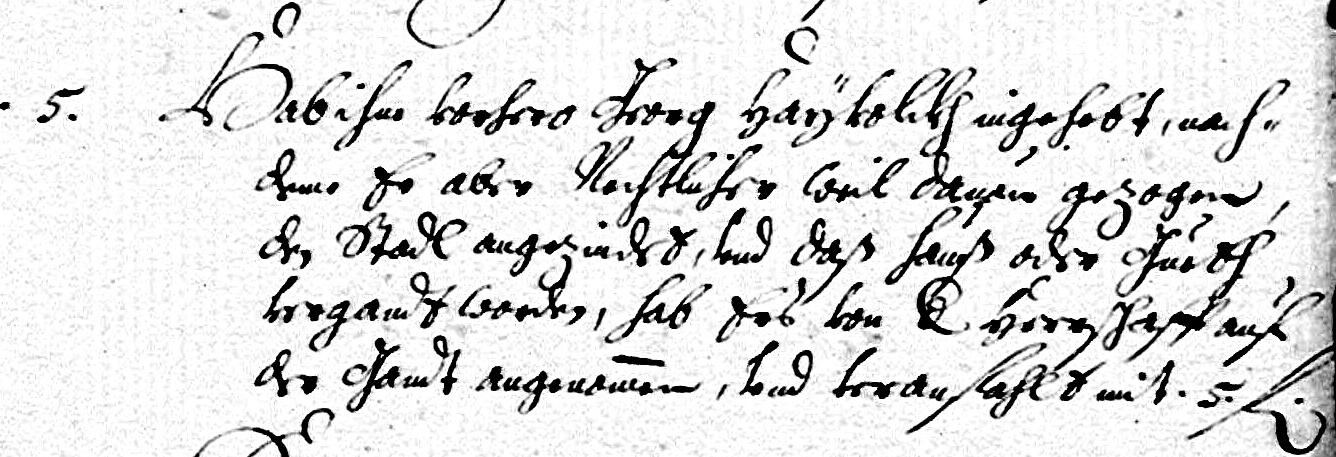
Georg Haykolckh ist von seinen Hof "nächtlicher weil
davon gezogen (und hat) den Stadel angezündet", worauf Haus oder
Gut vergantet worden. . Martin Thoma, vorher in Mittelstetten, hat
den Hof von der Herrschaft auf der Gant angenommen, später
Franzbauer Kreisstraße 48
Als größeres Anwesen ist noch der Müller zu nennen: Wolf
Vell (Yell) hat 1665 die Witwe von Michael Loder geheiratet,
Hauptstraße 40
1671 sind außerdem zehn Häusler genannt, die jeweils eine
Kuh besitzen. Ein Haus hat der Alt-Bauer Wolf Magg als
Austragshaus. Die Häusl stehen in Gruppen bei den Bauernhöfen.
Sie lassen sich weder auf spätere Hausnummern
zuordnen, noch ein Familien-Zusammenhang herstellen.
Insgesamt stehen 1671 also 15 Wohngebäude: 4 Bauernhöfe, der
Müller und 10 Häusler ohne Landwirtschaft.
Steuern eines Bauern nach Steuerbuch 1671
Nach der Abbildung oben steuerte Georg Tangler "außer Kleindienst
und 5 fl Scharwerksgeld an Getreide
2 Scheffel Roggen
4 Scheffel Korn (Weizen)
6 Scheffel Hafer (Pferdefutter)
nach Dachauer Maß.
Ursprünglich war der "Zehent" jede zehnte Getreidegarbe. Diese
einzusammeln war unpraktisch, weshalb man sich auf Ablieferung von
ausgedroschenem Getreide einigte. Scheffel ist ein Hohlmaß und
misst die Getreidemenge unabhängig vom Feuchtigkeitsgehalt. Ein
Scheffel ist etwa ein Doppelzentner und im Durchschnitt 6 Gulden
wert.
Kriege und ihre Auswirkungen auf Oberschweinbach
1704, im Spanischen Erbfolgekrieg, und 1741 wieder im
Österreichischen Erbfolgekrieg wurde Bayern von
Österreichischen Truppen besetzt. Das Militär wurde in ein anderes
Land als Besatzung geschickt, um sich auf Kosten der dortigen
Bevölkerung selbst zu versorgen. 1704 wurde das Dorf
Harthausen (bei Friedberg) abgebrannt. Für die Dorfbewohner
war die Besatzung eine Katastrophe. Die Soldaten nahmen der
Landbevölkerung mit Gewalt sogar die Existenzgrundlage weg. Sie
haben die Kuh geschlachtet, die sie melken wollten.
Die Österreichischen Hilfsvölker (Kroaten) brachen in das
Schloss Spielberg ein, fanden aber keine Schätze. Dafür
verwüsteten sie die Registratur. Alles vor 1704 fehlt. Ab
den 1730-erJahren sind nur Fragmente vorhanden. Bis 1754 fehlen
die Protokolle völlig. Um 1800 kamen zu allem Überdruss noch
französische Truppen und vernichteten wieder Protokolle. Es
liegt also an der großen europäischen Geschichte und Politik, dass
die Chronik unseres Dorfes lückenhaft ist. Nur die Pfarrer in
Günzlhofen haben ihre Bücher versteckt und bewahren können. Auf
die Pfarrmatrikel baut das vorliegende Häuserbuch. in der Zeit vor
1812.
Verwaltung der Hofmark, Gerichtsbücher
Die Hofmark war in ihrem Gebiet für alles zuständig, was
heute Finanzamt und Amtsgericht (mit Grundbuchamt)
erledigen. Da die Herrschaft weit entfernt hinter Regensburg in
Unterbrennberg wohnte, beauftragte sie den Hofmarksrichter, der
für Kloster Ettal die Hofmarken Aubing und Maisach verwaltete. Zu
bestimmten Gerichtstagen kam er mit seinem Schreiber nach
Spielberg und erledigte die Geschäfte in Spielberg im Nebenberuf.
Er kassierte dafür die anfallenden Gebühren.
Da 1704 alles Vorhandene vernichtet worden ist, musste er im
Mai 1704 ein neues Buch anfangen. Die Titelseite ist ein 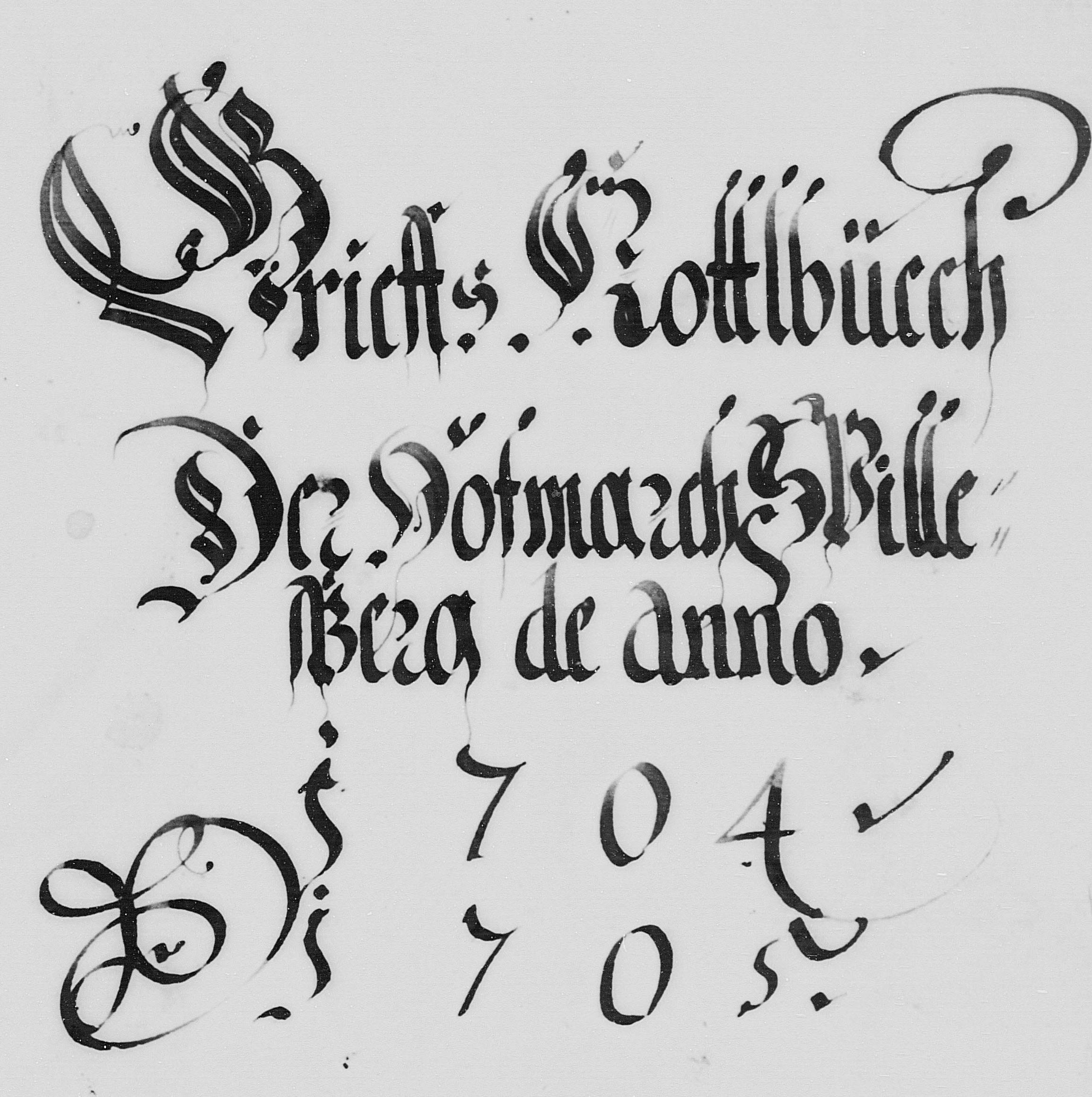
kalligraphisches Kunstwerk des Schreibers.
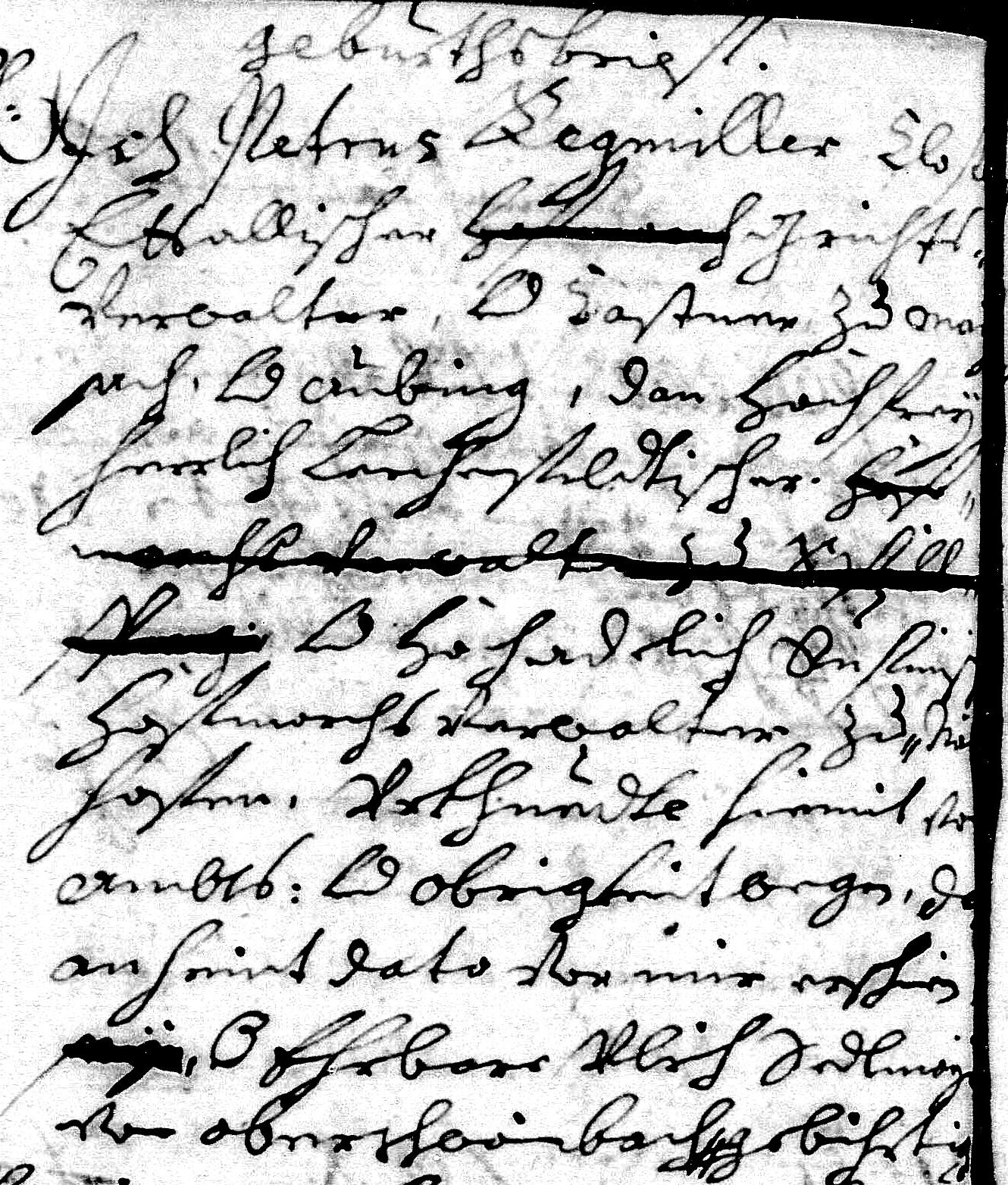
Geburtsbrief
Einen Geburtsbrief brauchte, wer sich außerhalb der Hofmark
nieder lassen wollte. In diesem Protokoll hat sich der
Richter persönlich vorgestellt.
Beispiel: 6.Juli 1728
Ich Petrus Segmiller Closter Ettalischer Gerichtsverwalter und
Kastner zu Maisach und Aubing, dann hochfreiherrlicher
Lerchenfeldischer und hochadelich Ruffinischer Hofmarksverwalter
zu Nannhofen verkünde hiermit von Amts- und Obrigkeit wegen dass
anheunt dato vor mir erschienen der ehrbare Ulrich Sedlmayr von
Oberschweinbach gebürtig .....
Zwei Zeugen, Anton Wenig Jäger, 50 Jahre alt und Hans Probst
Mesner zu Unterschweinbach 52 Jahre alt versichern an Eidesstatt,
dass des Antragstellers Ulrich Sedlmayr Vater und Mutter, beide
nunmehr seelig, vor 39 Jahren in der Kirche Weikertshofen
geheiratet haben, den Sohn Ulrich vor 31 Jahren in Günzlhofen
taufen ließen usw.
Oft steht im Geburtsbrief der Zielort, zum Beispiel am 30.7.1763
Josef Glück, Sohn des Schloßbauern erlernte in München das
Bortenmacher-Handwerk und ließ sich dann in Schrobenhausen nieder.
Der Richter war mit großem Eifer bei der Arbeit, denn die
Gebühren waren sein Einkommen. Der Schreiber musste flink sein,
alles mit zu schreiben. Die Dorfleute konnten nicht schreiben. Um
Geldbeträge zu quittieren, brauchte man den Richter und seinen
Schreiber. Bei Heiraten spielte das Heiratsgut eine große Rolle,
denn der oder die ein heiratende Partner/in erwarb mit dem
eingebrachten Heiratsgut das Hälfte-Miteigentum am Haus oder Hof.
Das wurde in einem Ehevertrag (Heiratsbrief) vereinbart und
die Zahlung vom Gericht überwacht.
Zur Hofmark Spielberg gehörten neben dem Ort Oberschweinbach noch
7 Anwesen in Mammendorf, 9 Anwesen in Unterschweinbach, ein Hof in
Waltershofen und eine Sölde in Pischertshofen. Baron Lerchenfeld
wird diese Höfe für seine Dienste beim bayerischen Herzog bekommen
haben. Arme Häusler brachten dem Herrn kaum Einnahmen, aber große
Bauernhöfe wie der Wirt oder der "Kaltenbacher" in
Unterschweinbach zahlten schon nennenswerte Beträge.
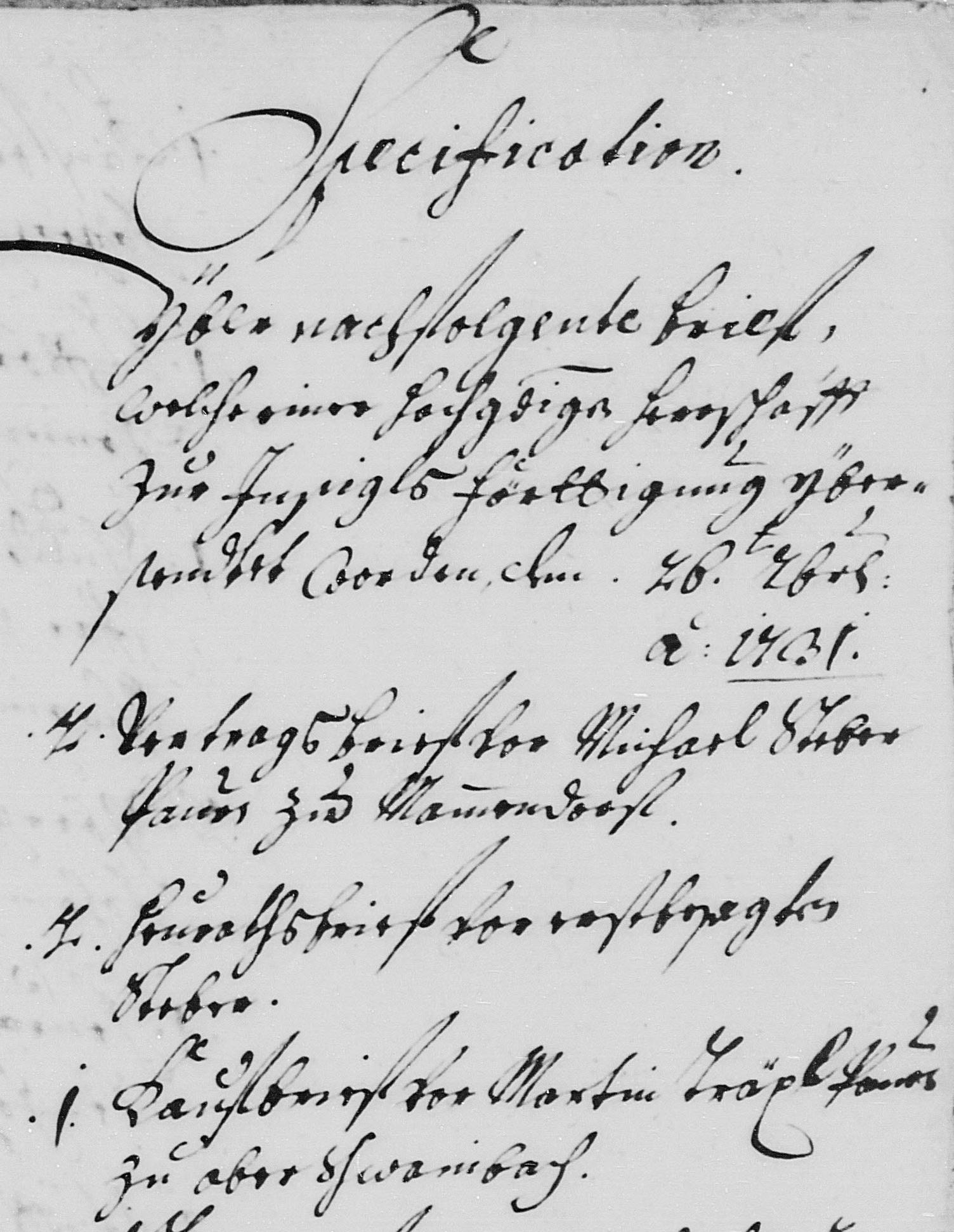
Siegelung der Urkunden durch Freiherr Lerchenfeld
Die vom Richter erstellten Urkunden wurden erst rechtskräftig,
wenn sie vom Hofmarksherrn mit Siegel versehen wurden. Die
Urkunden eines Jahres wurden gesammelt und am 26.September
1731 zu Baron Lerchenfeld gebracht.
Mit der Siegelung hatte der Hofmarksherr auch eine Kontrolle über
seine Einkünfte. Die Gerichts- Schreib- und Strafgebühren durfte
der Richter als sein Einkommen behalten, aber die größeren
Beträge, die Laudemien, kassierte die Herrschaft selbst. Heute
nennt man das Grunderwerbsteuer und Erbschaftssteuer. Damals
war das Laudemium (wörtlich "Herrenlob") bei jedem
Eigentümerwechsel einer Immobilie in Höhe von 7,5 % des
Verkehrswertes fällig. Bei Hofübergabe oder Erbschaft
wurde der Wert geschätzt, bei einem Kauf steht der Preis im
Vertrag und bei einer Einheirat ist es der Betrag des
Heiratsgutes. Wie heute gilt ein Vertrag erst
nach Zahlung der Steuer und bekommt das Siegel. Der Zugriff der
Behörde erfolgt in dem Moment, in dem das Geld auf dem Tisch liegt
und für die Zahlung aus dem Versteck geholt wurde.
Wegen der hohen Müttersterblichkeit nach den vielen Geburten mit
anschließender Wiederverheiratung des Mannes brachte das
Laudemium auf das Heiratsgut der Frauen gute
Steuer-Einnahmen.
Weitere Urkunden-Siegelung 14.August 1734
Ihro hochfreyherrl. Gnaden, hoch- und wohlgeborener Freyherr
gnädig hochgebietender Herr Herr.
Euer hochfreyherrl. Gnaden haben hierbei nach anschließender
Spezifikation 44 Brief untertänig übersenden wollen, dass
dieselben gnädig geruhen wollen, solche mit dem großen Insiegl
verfertigen und mir zurück kommen lassen, damit ich solche
selbig Untertanen zustellen khundte. Wobei die darbey liegenden
Reversbrief bei dero Gnädigen Händen zurück behalten werden
können.
Weil ... Johann Pals, Bauer seinen Anfall (=Laudemium)
100 Fl. ...(schon) erlegt , tue ich solchen ,, behalten,
bis Euer Graden verlangen, ob (ich) dieselben nach Aham
(Lerchenfeldische Hofmark Ammerland am Starnberger See)
oder ... Nymphenburg nach München ... erlegen
sollte.
Euer hochfreyherrlichen Gnaden berichte auch amtshalber
untertänig , dass Herrn Baron von Lerchenfeld Pfarrherr von
Endlhausen, ... .. Mittwoch, den 11. auf das Benefizium zu
Spielberg aufgezogen sei und auf derselben Verlangen nit
nur allein zu Abholung der Pagage eine Schwarwerkfuhr nach
München abgeführet, sondern auch vor (für) die 3 Bedienten die
nöthigen Maderanzen (Matratzen) und erdenes Kuchelgeschirr
ausfolgen zu lassen angeschafft habe, aber verboten habe, dass
der Gnädig Herrschaft Bett und Zinngeschirr versperrt und
verwahrt bleiben soll.
Die Rechnungen pro a. 1733, so bald selbige abgeschrieben ,
werde ich gleichfalls negstens ad Ratificandum untertänig
übersenden.
Das solang anhaltende Regen Wetter verursacht im hier ganzen
Revier ein allgemeines Lamento, weil sowohl Winter- als
Sommer-Gertreid im solang es regnet da liegen und stark
auswachset und auf noch lengers Anhalten Schlechte wenig zu Nutz
gebracht werden kann ....
Benefizium bei der Schloßkapelle
Ein Benefizium ist meist ein Altersruhesitz für einen
Priester mit ausreichenden Einkünften für den Lebensunterhalt,
aber ohne große Pflichten. Nur einmal wird ein Benefiziar in
den Spielberger Protokollen genannt, als ein
Testament-Vollstrecker bestellt wird . Nur über seine Köchin
wurde mehrmals vor Gericht geklagt.
Wirtshaus-Raufereien
In Oberschweinbach gab es vor dem Jahr 1800 keinen Wirt, aber der
Unterwirt in Unterschweinbach gehörte zur Hofmark. Wenn
Oberschweinbacher Bier trinken wollten oder eine Hochzeit
feiern, durften sie das nur in Unterschweinbach.
In Günzlhofen war auch ein Wirt, doch das war eine andere Hofmark,
gewissermaßen verbotenes Ausland. Bis die Oberschweinbacher
vom Unterwirt heim liefen, wurden sie wieder nüchtern.
Um 1730 wurde Johann Peter Vöst, ein gelernter Brauer, im Schloß als
Bräumeister angestellt. Er heiratet 1736 und lässt bis 1744
Kinder taufen. So lange gab es eine Brauerei im Schloß und im
Bräustüberl hat Vöst ohne landgerichtliche Konzession Bier
ausgeschenkt. Die Betrunkenen haben oft zu streiten
angefangen. Das führte zu gerichtlichen Protokollen.
1704 und 1705 enthält der Protokollband normale Notargeschäfte
(Hofübergaben, Heiratsbriefe, Nachlässe), doch dann sind plötzlich
ab 1716 datierte Fragmente von Strafsachen eingebunden.
Kriminalität kommt darin nicht vor. Es sind nur Bagatellen.
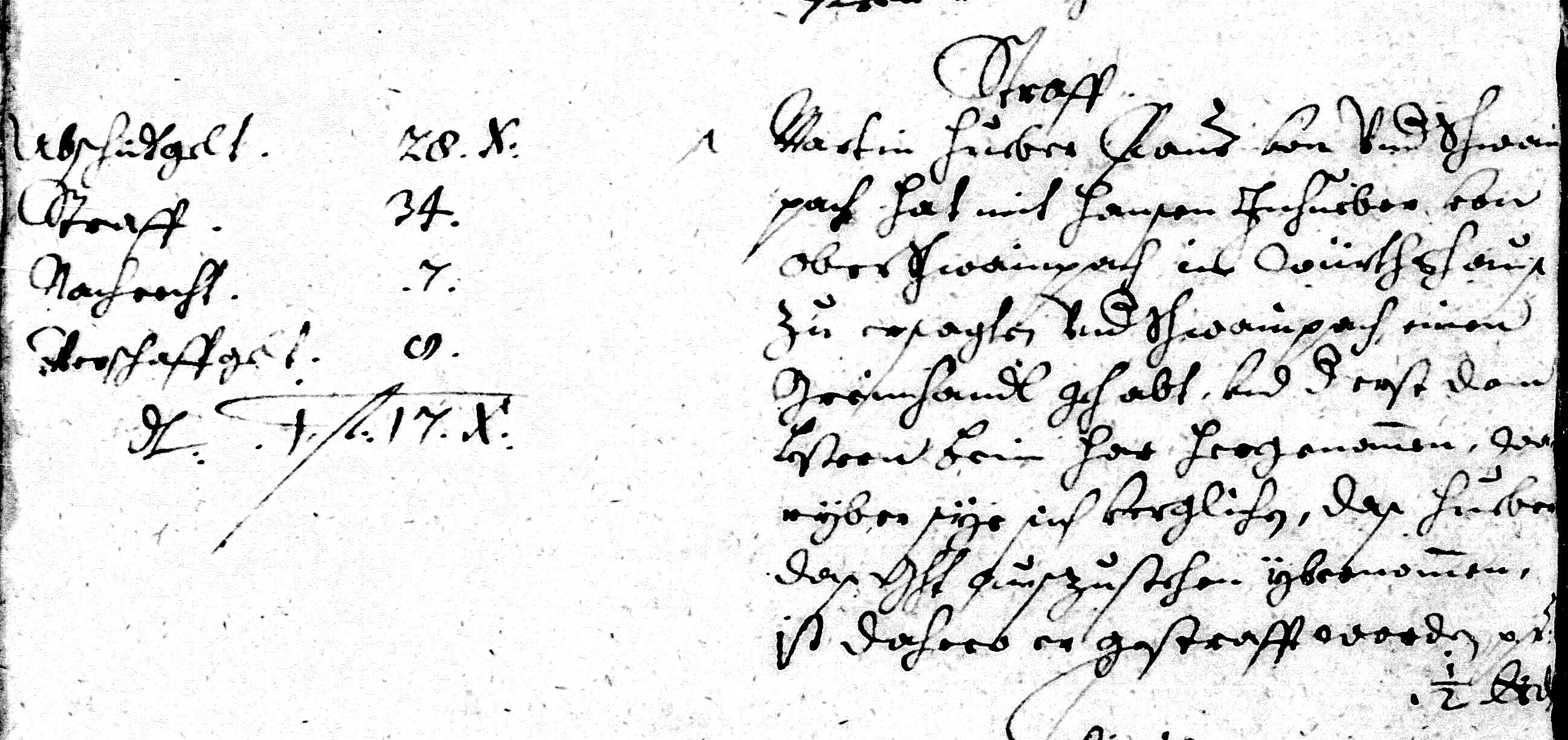
abgebildetes Beispiel (undatiert, 1716):
Straf: Martin Hueber Paur von Unterschweinbach hat mit Hansen
Inhuber von Oberschweinbach im Wirtshaus zu ersagtem
Unterschweinbach einen Grimhandl gehabt und der erste dem
letztern beim Haar hergenommen . Worüber sie sich verglichen ,
dass Hueber das Gericht auszustehen übernommen, ist dahero er
gestraft worden zu 1/2 Pfund Pfennig.
Links stehen die Gebühren: 1 Gulden 17 Kreuzer. Der Richter
durfte nicht willkürlich Strafen verhängen, sondern musste genau
nach dem Gesetz (Bayerisches Landrecht) verfahren. Deshalb tauchen
hier zwei Währungen auf: Im Gesetzbuch stehen als Strafmaß
die alten bayerischen Pfennige, von denen 240 ein Pfund
ergeben. In Gebrauch als Zahlungsmittel sind die kaiserlich
österreichischen Gulden, 60 Kreuzer (X) ergeben einen Gulden (fl =
nach Florentiner). Zwischen den Währungen gab es keinen festen
Wechselkurs. Der Wert des Gulden schwankte grob vereinfacht
mit dem aktuellen Goldpreis. Die Aufteilung der Beträge
zeigt, was dem Richter, dem Schreiber und dem örtlichen Polizisten
zu stand.
Die Eskalation zur Wirtshaus-Rauferei folgte genauen Spielregeln:
Nach Schmähreden folgten Beleidigungen, dann Handgreiflichkeit,
Ohrfeigen, "an den Haaren gezogen", "trockenes Gerauf",
"blutiges Geraufe" mit Wunden, die der Bader flicken
musste. Als Waffen dienten die Wirtshaus-Stühle,
zuerst die Stuhlfüße, dann der Rest des Stuhles . Nur einmal ist
ein Messerstich erwähnt, doch ernsthafte Verletzungen oder gar
Tote durfte es nicht geben. Beispiele für die Formulierungen:
"mit dem Bierschlegel aufm Kopf geschlagen"
"mit Streichen übel traktiert, dass er am linken Aug völlig
überschwollen und blau gewesen".
Der Wirt erhob nie eine Klage wegen Beschädigung des Mobiliars.
Die Bänke und Stühle waren so robust, dass sie die Rauferei
aushielten oder waren leicht reparierbar. Die Bierkrüge
waren aus Holz, vom Schäffler gefertigt und unzerbrechlich.
Für einen Mord wäre der Hofmarksrichter nicht zuständig gewesen,
sondern das Landgericht Dachau als nächsthöhere Instanz.
Heiratsalter und Kindersterblichkeit
Das Heiratsalter der Frauen lag um die 30 Jahren. Eine
dreißigjährige Frau hatte 10 Schwangerschaften zu erwarten. Wenn
sie schon mit 20 Jahren geheiratet hat, musste sie mit 20
Schwangerschaften rechnen. Die große Geburtenzahl war notwendig,
damit wenigstens ein oder zwei Kinder erwachsen wurden, eine neue
Generation gründen und die Alten versorgen konnten. Bei einer
Säuglingssterblichkeit zwischen 50 und 100 % gab es kein
Bevölkerungs-Wachstum. Es ist nicht möglich, eine Statistik
der Kindersterblichkeit zu erstellen, denn vor 1810 haben die
Pfarrer zwar die Kinder im Taufbuch, aber nicht im Sterbebuch
eingetragen. Die Kinder wurden ohne große Zeremonie in einer Ecke
des Friedhofes begraben. Gut situierten Müttern, Frauen von
Großbauern, ist es schon gelungen mehrere Kinder aufzuziehen und
den Zeitabstand zwischen den Geburten von ein auf zwei bis drei
Jahre zu verlängern.
In den Putten, die sich um die Barock-Altäre fröhlich tummeln,
sahen die Frauen ihre gestorbenen Säuglinge wieder und konnten
jedem Putto einen Namen geben.
Leichtfertigkeitsstrafen
Als "Leichtfertigkeit" wurde bestraft, wenn eine nicht
verheiratete Frau schwanger wurde oder schon nach weniger
als 9 Monaten nach der Heirat geboren hat.
Beispiel
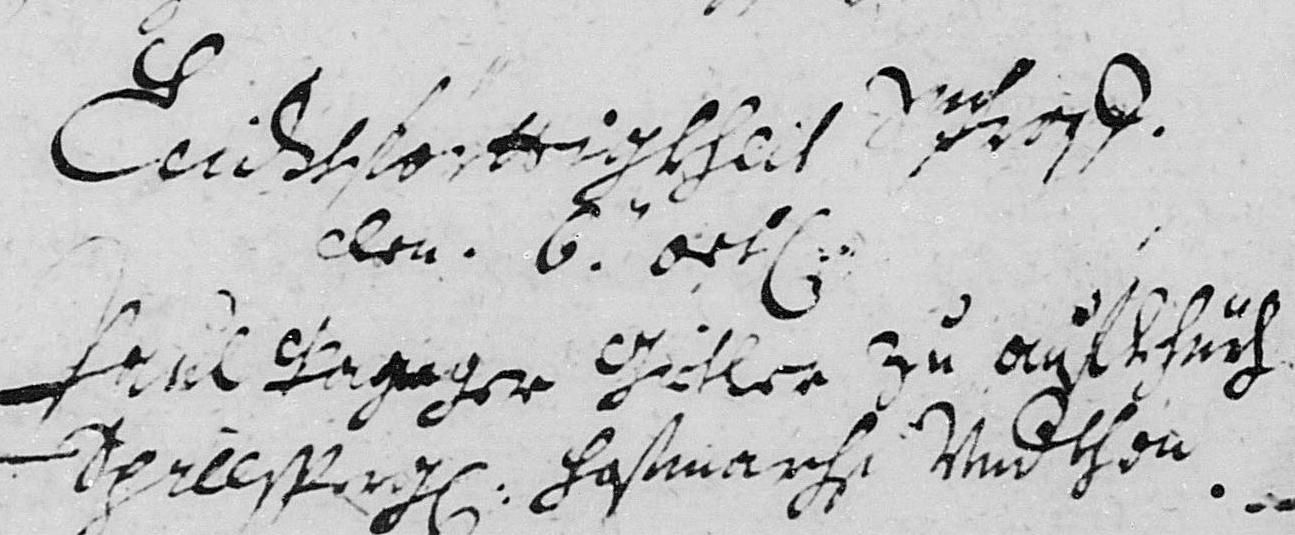
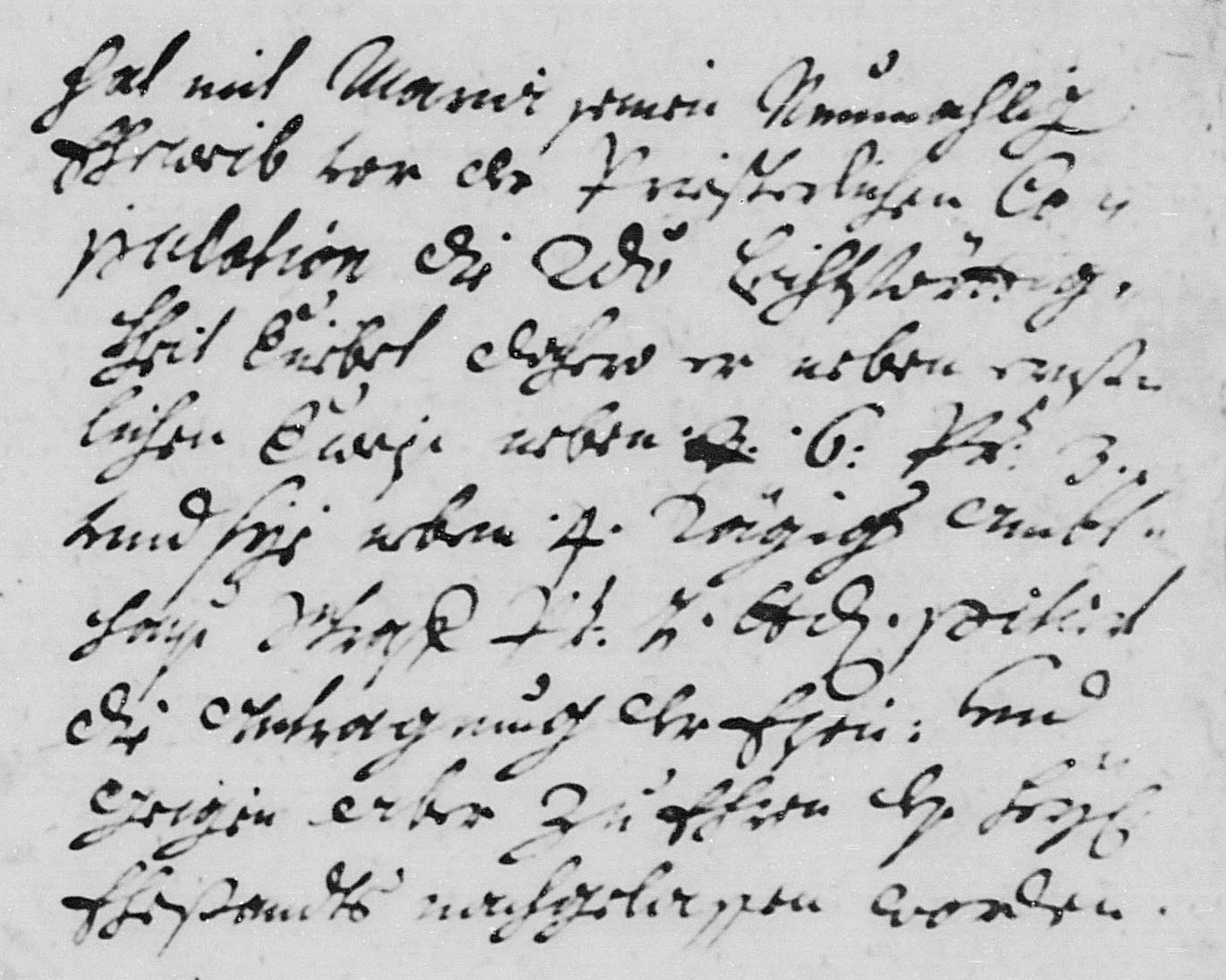
Leichtfertigkeits-Straf den 6. Oktober (1734)
Paul Wagner Gütler zu Aufkirchen Spielberg(ischer)
Hofmark Untertan hat mit Maria seinem nunmaligen Eheweib vor der
priesterlichen Copulation die rdo (reverendo) Leichtförtigkeit
verübt, dahero er neben ernstlichen Verweis neben 6
und sie neben 4 tägiger Amtshaus Straf per 2 Pfund Pfennig
(verurteilt). die Antragung der Eisen und Geigen aber zu Ehren
des heiligen Ehestands nachgelassen worden.
Strafe 7 Gulden.
Der Titel "leichtfertig" klingt seltsam, ist aber
zutreffend. Es war aus damaliger Sicht unverantwortlich, Kinder zu
erzeugen, deren Existenz nicht gesichert war.
Ein junger kräftiger Bauernknecht bekam als Jahreslohn vor dem
Jahr 1800 nur 10 Gulden, ausbezahlt an Maria Lichtmess, 2.
Februar. Dazu bekam er vom Arbeitgeber Essen, einfache
Arbeitskleidung, eine Schlafstelle im Haus und eine
Beschäftigungsgarantie für ein Jahr.
Bei armen Frauen (Bauernmägden) hatte der Richter das
Problem, dass sie keine Strafe bezahlen konnten. Da blieb nur die
"Schandstrafe" , sie wurden am Sonntag vor der Kirche in die
"Geige" gesperrt. Das war ein Holzgestell um den Hals, an
der Kirchenwand befestigt, um Übeltäter dem Spott der Gemeinde
auszusetzen. Für die Männer gab es den "Block" oder "Eisen"
(angekettete Handschellen) in den sie mit Händen und Füßen
eingesperrt wurden. Gerne wartete der Richter mit der
Vollstreckung einige Wochen, ob die Deliquenten nicht doch einige
Gulden brachten und demütig darum baten, die Schandstrafe in eine
Geldstrafe (in die Tasche des Richters) umzuwandeln.
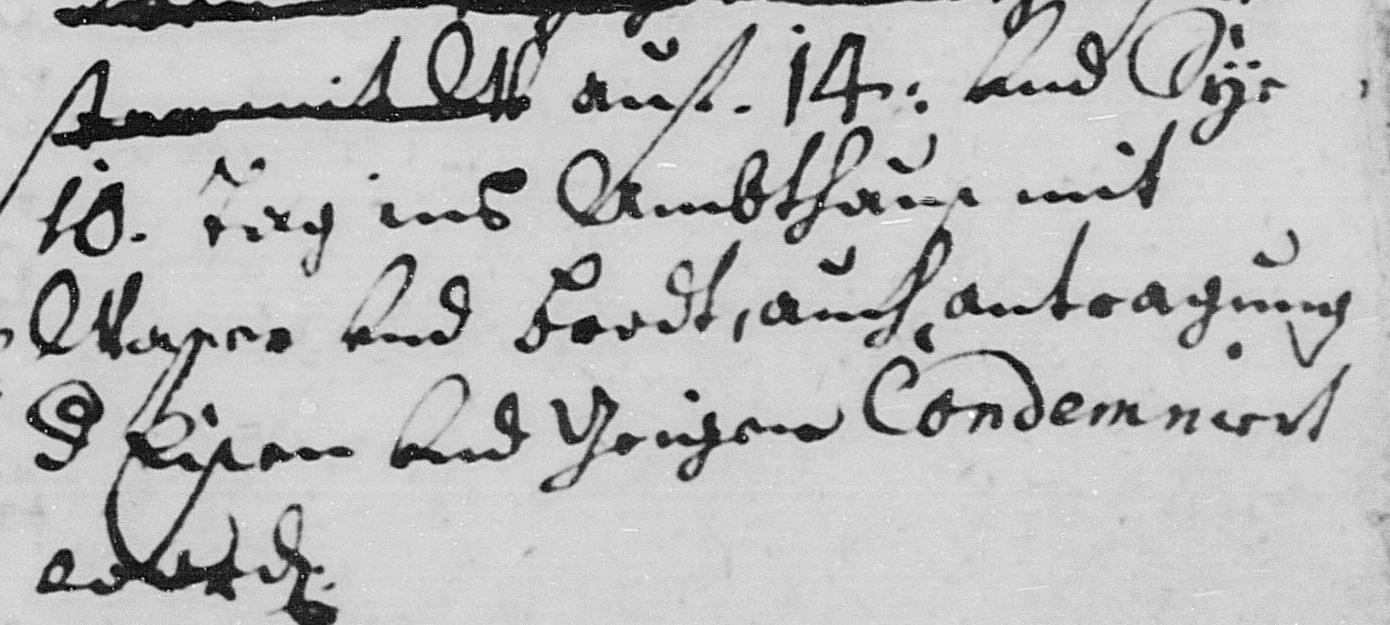
12.2.1731 Ein Bauernknecht hatte eine Bauernmagd geschwängert.
Strafe er "auf 14 und sie 10 Tag ins Amtshaus mit Wasser
und Brot, auch Antragung der Eisen und Geigen
condemniert worden."
Nach heutigen Vorstellungen sind die Leichtfertigkeitsstrafen
unverschämt, verfolgten jedoch einen bestimmten Zweck:
Sozialsystem der Barockzeit
Die soziale Absicherung der Landbevölkerung bis 1865 baut auf
zwei Voraussetzungen:
1. Nur verheiratete Paare dürfen Kinder bekommen
2. Nur Paare mit Immobilien-Eigentüm dürfen heiraten.
Diese Prinzipen wurden rigoros durch gesetzt, das zweite
mit Erfolg. Die unehelichen Kinder wurden so schlecht behandelt,
dass sie nach 3 Wochen in den Himmel kamen.
Mit zwei Elternteilen war die Existenz der Kinder gesichert, bis
sie ab dem 12. Lebensjahr "ihr Stück Brot selbst verdienen"
konnten.
Die Immobilie, selbst ein kleines Häusel, sicherte die Familie.
Arbeitsunfähige Alte übergaben das Haus an die nächste Generation
und ließen sich dafür versorgen. Waren keine eigenen Kinder
vorhanden, fand sich jemand in der Verwandtschaft oder ein fremder
Käufer für das Haus.
Das Idealmodell ist: Ein Paar heiratet mit 30 Jahren,
wirtschaftet auf dem Haus bis zum 60. Lebensjahr und übergibt an
das älteste Kind, das dann etwa 30 Jahre alt ist. Das Heiratsgut
des einheiratenden Partners ist der halbe Wert des Anwesens.
Damit kann ein Geschwister des erbenden Kindes in ein
gleichwertiges Anwesen einheiraten. Das Heiratsgut läuft
also nur im Kreis. Bei ein oder zwei Kindern geht die
Rechnung auf. Weiteren Kindern blieb nur der soziale Abstieg
in ein kleineres Anwesen, für das der Erbanteil reichte. Gab es
kein Erbe, war lebenslanger Dienst als Knecht oder Magd eines
Bauern das ausweglose Schicksal.
Wovon lebten die Oberschweinbacher vor 1800
Zunächst sind die 4 Bauern zu nennen, nach heutiger Terminologie
Vollerwerbs-Landwirte. Die vier Höfe liegen verstreut im Gelände.
Es waren ursprünglich Einödhöfe, Einzelhöfe. Um jeden Hof
scharten sich Tagwerker-Häuschen. Hier wohnten Familien, die
während der Arbeitsspitzen zur Erntezeit beim Bauern mit
gearbeitet haben und dafür etwas Getreide bekamen. Die übrige Zeit
des Jahres versuchten sie auf andere Weise Geld zu
verdienten.
Der Müller hat das Getreide zu Mehl gemahlen. Das kleine
Wasser-Rinnsal musste er im Weiher aufstauen, damit es kurze Zeit
sein Mühlrad angetrieben hat. Groß konnte der Betrieb nicht
werden, es reichte gerade für den örtlichen Bedarf. Dafür hatte
unser Müller kein Hochwasser-Problem wie die Mühlen an größeren
Gewässern.
Alle anderen Oberschweinbacher waren Tagwerker mit
Nebenverdienst. Vor 1800 hatten sie keine Landwirtschaft, keinen
Getreideacker, aber eine Kuh, die in der Gemeinde-Herde mit
gelaufen ist und fast ganzjährig im Freien war. Stall gab es vor
1800 keinen und nur eine kleine Menge Winterfutter für Tage mit
Schnee. Die Kuh sicherte die Milch-, damit Eiweiß und Fett-Nahrung
der Familie.
Die Gemeindeherde wurde vom Hüter betreut. Er war ein
Angestellter der Gemeinde und wohnte im Hüthaus oder Gemeindehaus.
Er war der einzige, der ohne eigene Immobilie eine
Heiratserlaubnis bekam. Dafür war die Gemeinde gegenüber dem Hüter
unterhaltspflichtig. Die Fluktuation der Hüter war enorm.
Oft waren sie nur ein Jahr in einem Ort, dann suchten sie wo
anders unter zu kommen.
An feuchten Stellen hatten die Häusler ein "Krautstück" eine winzige
Parzelle für Kraut und Rüben. Viel Gemüse, wie Kartoffeln, Tomaten
und Gurken kannte man noch nicht, wusste aber
welche Wildpflanzen und Früchte essbar waren.
Hühner waren nachts unter der Eckbank in der Stube sicher unter
gebracht. Brennholz holte man aus dem Gemeindewald. So waren auch
die Häusler autark, lebten aber so ärmlich, dass sie kaum Kinder
aufziehen und mit Heiratsgut ausstatten konnten.
Gewerbe in Oberschweinbach vor 1800, Neubauten von 1671 bis 1812
Im Steuerbuch 1671 wird nur bei Simon Winklmayr als
Beruf Kaminkehrer angegeben. Über die Kamine folgt unten ein
eigenes Kapitel.
Gehen wir in der Reihenfolge der Hausnummern von 1812 durch den
Ort: Bauern und Müller sind ausgelassen, es geht nur um die
anderen Berufe.
1. Der Schloßschmied ist ab etwa 1700 nachweisbar. Schmied
war ein "Ehhaft"-Gewerbe. Die Gemeinde garantierte den
Lebensunterhalt, der Schmied verpflichtete sich zur
Arbeitsbereitschaft, um schadhafte Geräte oder Hufeisen sofort zu
reparieren, insbesondere zur Erntezeit, Eine ausführliche
vom Gericht protokollierte Vereinbarung zwischen Gemeinde und
Schmied ist für Rieden (Gericht Friedberg) erhalten.
2. In Haus-Nr. 2 hat sich um 1700 ein Bäcker versucht. Bald gab
es bei jedem Haus oder für zwei Nachbarhäuser gemeinsam einen
Backofen. Als alle selbst Brot gebacken haben, wird kein Bäcker
mehr genannt.
5. Beim Bergschuster, Haus-Nr. 5 wurde der Beruf zum Hausnamen,
ab etwa 1730
6. Der Schäffler Haus-Nr. 6 ist seit etwa 1700 nachweisbar.
7. Der Hausname Galland stammt von Gail oder "Gall
And"(reas). Als Beruf der Besitzer wird einmal Weber
genannt.
8. Ein Kramer läßt ab 1726 Kinder taufen. Ob die Frau des Jägers
Michael Sedlmayr Krämerin war ? Zu Jägerhaus, Jägersölde,
Jägergütl und Jägerbauer siehe die Geschichte des Jägers Anton
Wenig.
9. Um 1764 kaufte die Wagner-Familie Rupp aus Moorenweis,
11. Haus-Nr. 11 wurde um 1705 vom Zimmermann Markus Vöst gebaut
und bekam nach ihm den Hofnamen "Marx"
13. Von Haus-Nr. 13 ist der Haus-Name interessant. Der
"Hefenmann" holte die Bierhefe frisch aus der Brauerei (die
nächste war in Maisach) und verteilte sie in kleinen Mengen an die
Hausfrauen, die damit ihren Brotteig mischen konnten.
16. Der Hafner hat sich 1709 angesiedelt
18 und .25. war auch ein Schuster. Damit gab es bis zu
drei Schuster im Ort.
19. In Haus-Nr. 19 wohnte ein Weber.
20. und 29 Schneiderhans und Schneiderpeter waren keine
Schneider, sondern Familiennamen.
22. Zu Haus-Nr, 22 gibt es keine Berufsangaben.
24. "Sticker" klingt nach einem Beruf.
26. wird einmal als Rechenmacher bezeichnet
27 "Schleifer" könnte ein Messer- und Werkzeugschleifer sein.
36. Der Schloßmaurer zeigt ab 1792, dass die Holzhäuser
allmählich durch gemauerte Häuser ersetzt wurden.
37. und 38 Die Hofnamen Mühlhauser und Grub scheinen sich auf
die Lage des Hauses zu beziehen.
Urkunden ab 1756
Nachdem bis 1735 nur noch Fragmente der Protokolle
vorhanden sind, wurde 1756 nach Abzug der österreichischen
Besatzung wieder ein neuer Band angefangen. Manchmal enthalten die
Urkunden Details.
7.März 1757
Der Witwer Matthias Schädl, Häusler Oberschweinbach verkauft
sein Haus um 120 Gulden an Peter Klaß, Zimmermann aus
Pfaffenhofen. Im Preis enthalten sind der Garten, ein
Krautstückl (Krautacker-Anteil) eine Kuh, ein kupferner
Waschkessel, 1 Stroh- und Gsottstuhl, ein Rübenschaff
Der Verkäufer behält das Wohnrecht im Häusl, Liegebett, Hals und
Bein-Gewand Ein- und Ausgang in der ordinari Wohnstuben, die
Liegestatt in der oberen Kammer, welche auf seine eigenen Kosten
zu reparieren lebenslänglich ausgenommen, zur Pfriembd (Pfründe)
blos von dem im Gärtl stehenden Holzbirn-Baum das 3. Viertel, so
einige geraten.
Geldanlagen und Darlehen bei der Schloßkapelle
Die Sankt Salvator-Schloß-Kapelle in Spielberg hatte die Funktion
wie die späteren Raiffeisen-Kassen. Verwaiste Kinder hatten
Anspruch auf das Erbe, mindestens das Heiratsgut der Mutter.
Dieses Geld musste vom Vormund mündelsicher angelegt werden, als
Einlage bei der Schloßkapelle. Das Eigenkapital der Kapelle
(Benefizium) diente dabei als Einlagen-Sicherung. Das angelegte
Geld wurde in kleinen Teilbeträgen gegen Sicherheiten und Zins
verliehen, etwa zum Kauf oder Bau eines Hauses. Der Kreditnehmer
stellte als Sicherheit noch Bürgen.
Ab 1763 nehmen diese Geldgeschäfte in der Spielberger
Hofmarks-Urkunden breiten Raum ein. Der Hofmarksrichter erledigte
den Schriftverkehr, protokollierte Einlagen und Kredite
(Schuldbriefe), Bürgenstellung, kontrollierte die fristgerechte
Rückzahlung von Raten und erstellte die Quittungen dazu. Die
Gebühren waren sein Honorar. Der Zins war das Einkommen des
Benefiziars.
Staatliche Mißwirtschaft machte das zu einem
Schneeballsystem: Der barocke Staat war bankrott, Kriege
und fremde Besatzung mutwillig. Da hatten die Leute
keine Bedenken, für die Besatzungslasten Kredite aufzunehmen, die
sie niemals zurück zahlen konnten und wollten. Als der bayerische
Staat mit der Säkularisation den vermeintlichen Reichtum der
kirchlichen Institutionen enteignete, platzte die Blase. Es waren
alles uneinbringliche Forderungen. Betrogen war nur,
wer gutes Geld in die Kasse eingelegt hatte.
Mißernte 1767 - 1770
Am 22. 2. 1768 protokolliert die Hofmark Spielberg einen
gemeinsamen Schuldschein der Bauern über 1000 Gulden, "wegen
des erlittenen Totalschauer zur Erkaufung von Speis- und
Sam-Getreide aus Händen unserer hochgnädigen Hofmarks-Herrschaft.
zu Spielberg". Wir können annehmen, dass die
Getreide-Abgaben der Bauern Jahre oder Jahrzehnte lang nur
im Schloß-Dachboden eingelagert wurden und erst bei einer so
günstigen Gelegenheit teuer verkauft wurde.
Der Vorgang ist dubios. Erst geht es nur um 100
Gulden, dann aber um 1000. Die Summe ist mit 5 %
"landsgebräuchig" zu verzinsen und am 15,2,1769 zurück zu
bezahlen.
Die Schuld von 1000 Gulden verteilt sich auf
Bauern in Oberschweinbach
Jakob Träxl, Bauer 287 fl 30 Xr
Michael Träxl 187 fl., 30 Xr
Franz Steber Schloßbauer 150 fl
Franz Lichtenstern 100 fl
Peter Wurm 50 fl
Unterschweinbach
Martin Kistler 100 fl
Johann Pläbst Kumpfmüller 50 fl.
Franz Huber Gütler 25 fl
Aufkirchen
Johann Sigler Halbbauer 25 fl
Ferdinand Böck 25 fl
Summe 1000 Gulden.
So teuer konnten selbst Wucherpreise für etwas Saat- und Speise-
Getreide nicht sein. Da wurden die Bauern übertölpelt.
Den Schuldschein über 1000 Gulden konnte der
Hofmarksherr einem Bankier als Pfand geben und damit selbst
Schulden machen. Alle Beteiligten wussten , dass das Papier nichts
wert war, weil die Bauern nicht in der Lage waren, die Beträge zu
bezahlen und nicht eingesehen hätten, dass sie zu ihrem
Schaden auch noch die Verschwendung der Herren ausgleichen
sollten.
Ursache der Mißernte könnte ein wegen Ausbruch eines
Aschenvulkans verregneter Sommer sein. Der Vesuv (Italien)
war in diesen Jahren aktiv, wobei eine Aschen-Eruption in der
Umgebung des Vulkanes wenig Schaden anrichtet, wenn der Wind die
Asche in höhere Luftschichten verteilt.
Die Münchener Stadtchronik berichtet ebenfalls von einer
Hungersnot und im ganzen Gebiet sinken 1769 1770 die
Geburtenzahlen drastisch.
Geburten in Pfarrei im Jahr:
|
1765
|
1766
|
1767
|
1768
|
1769
|
1770
|
1774
|
1772
|
1773
|
1774
|
Günzlhofen
|
30
|
26
|
32
|
24
|
30
|
19
|
24
|
18
|
25
|
30
|
Baindlkirch
|
29
|
20
|
22
|
15
|
5
|
11
|
15
|
22
|
22
|
30
|
Aufkirchen
|
26
|
34
|
25
|
27
|
29
|
26
|
19
|
11
|
18
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bauern konnten den Ernte-Ausfall durch Kauf von Getreide auf
Kredit ausgleichen. Für die armen Häusler-Familien waren
Kriegs- und Naturkatastrophen existenzvernichtend.
Kartoffeln waren 1770 in Oberbayern noch unbekannt. Man ernährte
sich fast nur mit Getreide.
Ein weiteres Mißernte-Jahr ist besser erforscht: Im April 1815
brach in Indonesien der Vulkan Tambora aus. Seine Asche in der
Luft ließ auf der Nordhalbkugel der Erde den Sommer 1816
ausfallen. 1816 war die Krise schlimmer als 1769, denn der
bayerische Staat hatte nach der Säkularisation der Klöster (1803 -
1806) deren enorme Getreide-Vorräte verkauft, Im Krisenjahr war
nichts mehr vorhanden. Protokolle für das Jahr 1816 fehlen in der
Hofmark Spielberg.
Heute wissen wir: Die Ursache der Mißernten war eine
Klima-Verschlechterung. Ab dem Mittelalter wurde es
ständig kühler, erkennbar am Wachstum der Alpengletscher.
Erst 1850 kehrte sich der Trend um. Seitdem wird es wärmer.
Umstellung auf Stallviehhaltung
Die Klima-Verschlechterung erzwang eine Umstellung der seit 2000
Jahren üblichen Landwirtschaft.
Der Getreide-Anbau erfolgte bis um 1800 in der
Dreifelder-Wirtschaft. Jede "Lage" war in drei Felder eingeteilt,
jedes Feld eingezäunt. Jeder Bauer hatte einen Anteil an jedem
Feld. Im Wechsel wurde einmal Sommergetreide, dann
Wintergetreide angebaut und ein "Feld" lag brach und wurde von der
Gemeindeherde ab geweidet und gedüngt. Kurz vor 1800 wurde
die Dreifeldwirtschaft aufgegeben und von Weidevieh auf
Stallviehhaltung um gestellt.Die Gemeindeherde gab es nicht mehr.
Die Gemeindegründe wurden gleichmäßig an die Häusler
verteilt. So wurden diese zu Klein-Landwirten. Die
Kühe ließen den Mist nicht mehr direkt auf den Acker fallen,
sondern die Menschen brachten den Mist vom Stall auf den Acker.
Die nun verteilten, vorher nur beweideten schlechten Böden sollten
von den neuen Kleinbauern intensiver als Ackerland bewirtschaftet
werden..
Die Gemeindegründe wurden absichtlich nicht an die großen Bauern
verteilt, denn diese wussten, dass darauf kein Getreide wuchs. Nur
die armen Leute plagten sich damit ab.
Von 1800 bis 1950 wurde die Landwirtschaft von den Häuslern
so betrieben. In den beiden Weltkriegen hat sich das bewährt und
das Volk vor dem Verhungern bewahrt. Als die Männer in den Krieg
mussten, haben die Häusler-Frauen alleine gearbeitet und weiter
Lebensmittel produziert, während die Bauern den Betrieb
einstellten, nachdem ihnen das Militär die jungen männlichen
Arbeitskräfte und die Pferde weg genommen hat.
Um 1950 haben die Kleinbauern die Landwirtschaft
aufgegeben und sich andere Arbeit gesucht.
Bewirtschaftung und Verteilung der Schloßgründe
Der Hofmarksherr heißt nicht mehr Lerchenfeld, sondern
Leyden, Barocke Adelsnamen und Titel passen nicht auf einen
heutigen Personalausweis.
15.10.1799
Pacht-Contract
welcher zwischen dem hochwohlgeborenen Herrn
Herrn Franz Xaver des heil römisch. Reichs Freiherrn von
Leyden auf Affing, Berg, Essenbach und Mattenhofen, Herr der
Hofmark Spielberg, seiner churfürstl. Durchlaucht zu
Pfalzbayern wirkl. Kammerer und Revisionsrat an der einen
dann den Orts-Spielbergischen Untertanen am anderen Teil,
wegen den .... herrschaftlichen Oekonomie-Feldern und
Wiesmathen, Ängern und Weihern auf vorhergegangenen
beedseitigen reife Überlegungen errichtet worden.
Erstlichen überlassen und verpachten
obgedachte .... Gnaden von Leyden den 9 Untertanen die bisher an
Veit Christoph Peyerl Gerichtsverwalter zu Spielberg seit
28.12.1788 ebenfalls pachtweis genossene Feldgründe, die 1785
geometrisch ausgemessen, beschrieben und in Plan gelegt wurden ,
in allen 3 Feldern von Nr. 1 bis 70 ...
.. sämtliche Feldgründe sind vom bisherigen Pächter
Peyerl in den letzten 6 Jahren im Winterfeld beguillet
worden, mithin in dem besten Zustand sich befinden".
Das Wort "Gülle" wurde schon gebraucht. Winterfeld, das trifft in
der Dreifelder-Wirtschaft jedes dritte Jahr, also zweimal in
den 6 Jahren wurde Mist gestreut.
Der Berechnung der Pacht wurde der Ertrag zugrunde gelegt. Hier
taucht neben Weizen, Korn (=Roggen), Gerste und Hafer auch
"Kern" auf. Das ist Dinkel, der in schlechten Jahren unreif als
"Grünkern" geerntet werden konnte und erst durch Rösten in
einer Darre genießbar wurde.
Kataster von 1812
1812 gab es eine Bestandsaufnahme zum Zweck einer einheitlichen
Steuer-Erhebung, diesmal für den ganzen neuen Staat Bayern. Steuer
auf Grundstücke war noch immer die wichtigste Steuer, denn
"Einkommen" gibt es in einer Selbstversorger-Naturalwirtschaft
nicht.
Die Grundstücke wurden vermessen, deren Ertrag geschätzt und
Hausnummern vergeben.
Wir kommen auf 38 Hausnummern. Wann die 23 neuen Häusel
gebaut wurden, verraten die Archivalien nicht. Ab 1812 lassen sich
die Hausbesitzer lückenlos belegen und passen zu den Familiendaten
in den Pfarrbüchern. Nur der "Datenschutz" in der Gegenwart
setzt einer Veröffentlichung wieder eine Grenze, so um die Zeit um
1900.
Die Glasfabrik
Um 1800 kam im Bayerischen Wald die Glasherstellung in Schwung.
Die Familie Baron Lerchenfeld wohnte im Bayer. Wald und wollte
auch in ihrer Hofmark eine Glasfabrik gründen.
Erst brauchte man ein Fabrikgebäude, um dieses zu bauen
Ziegelsteine, und um diese zu brennen eine Ziegelei. Die Ziegelei
und noch mehr die Glasfabrik braucht viel Brennholz. Dafür wurde
ein größeres Waldstück gerodet und seitdem als Acker genützt,
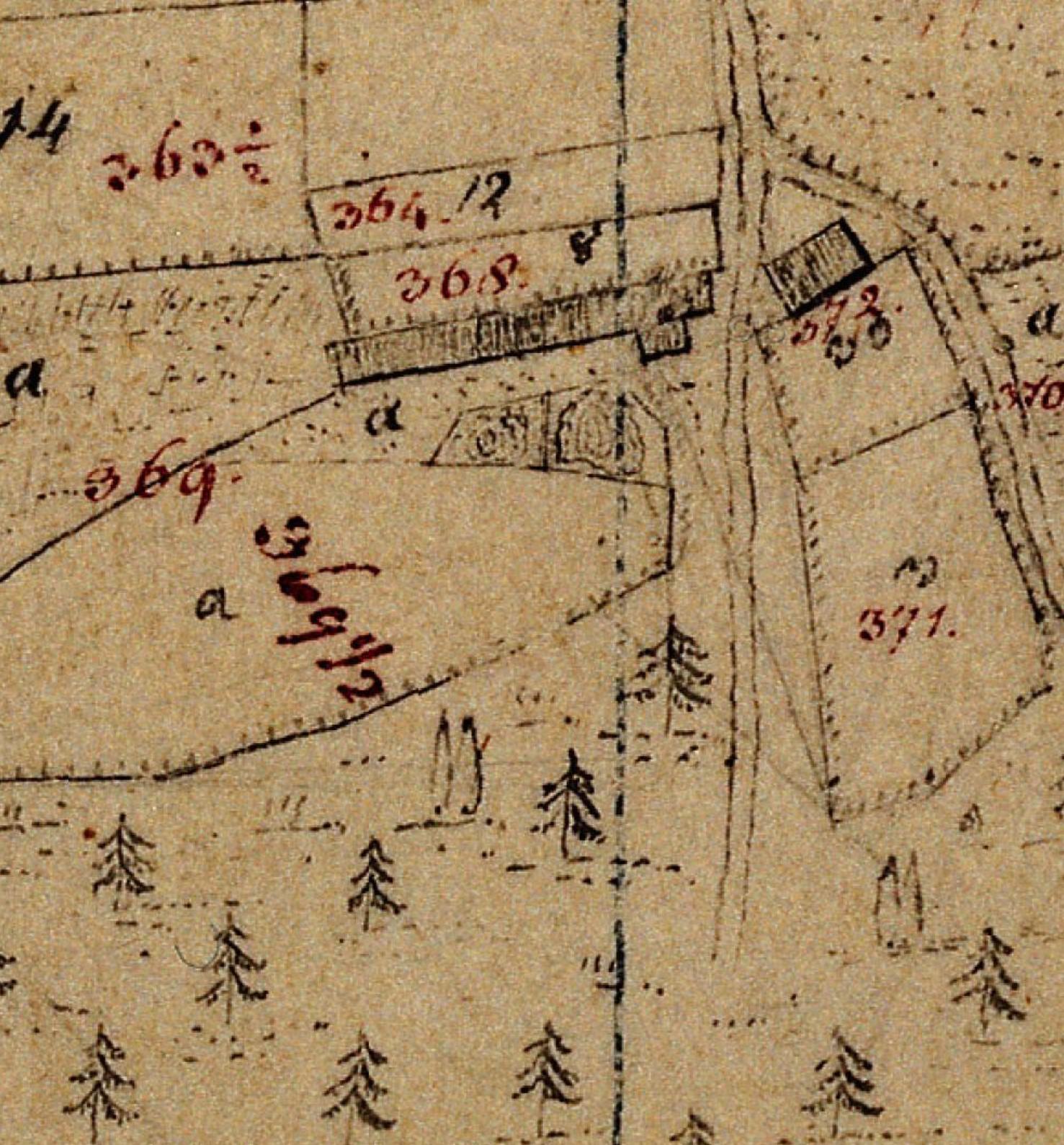
Die Ziegelei war am Feldweg-Ausläufer des heutigen Fichtenweg.
Gleich südlich davon war auf der Karte von 1812 noch Wald bis
Nannhofen. Die Ziegelei hatte das Holz gleich vor der Türe, Lehm
und Wasser auch.
Ohne engagierte Führung läuft eine Fabrik nicht. Die Qualität der
Produkte der Glasfabrik und der Ziegelei war ungenügend. Deshalb
sind beide Betriebe bald wieder eingegangen.
Ein Bierwirt für Oberschweinbach ab 1800
Neben der Glasfabrik wurde das erste gemauerte mit Ziegeln
gedeckte Haus, eine Bierschänke gebaut. Die am Feuer arbeitenden
Glasmacher hatten viel Durst.
Weil ein privates Steinhaus etwas neues und besonderes war, steht
es ausdrücklich im Kaufvertrag:
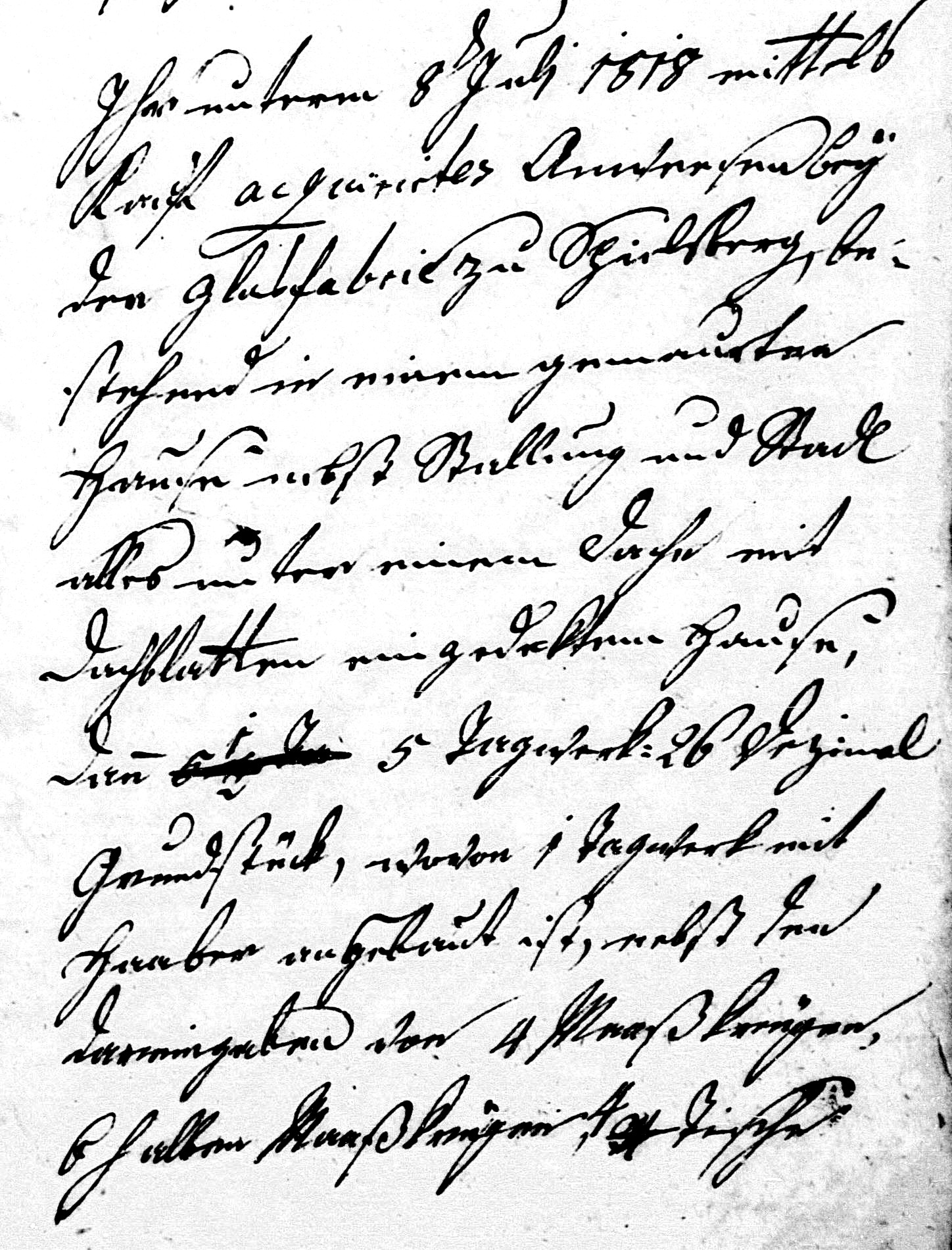
"... ihr unterm 8. Juli 1818 mittels Kauf aquiriertes Anwesen
bei der Glasfabrik zu Spielberg bestehend aus einem gemauerten
Hause nebst Stallung und Stadl alles unter einem Dache mit
Dachplatten eingedecktem Hause, dann 5 Tagwerk 26 Dezimal
Grundstück, wovon 1 Tagwerk mit Hafer angebaut ist nebst den
Dareingaben von 4 Maßkrügen 6 halben Maßkrügen , 4 Tische. "
Mit 4 Maßkrügen und 6 Halbe-Krügen war der Wirt nicht gerade üppig
ausgestattet. Die Bierkäufer brachten ihren Krug mit und tranken das
Bier zu hause.
Feuerstättenschau, Einbau von Kaminen
Im Steuerbuch 1671 wird Simon Winklmayr als Kaminkehrer genannt.
Danach taucht dieser Beruf nicht mehr auf, denn einen Kamin gab es
nur im Schloß.
Die einfachen Häuser hatten einen "Herd". Das war ein tischgroßer
Mauerblock mit einer Vertiefung für das Feuer in der
Mitte. Der Rauch zog durch das Strohdach ab . Er konservierte
das Strohdach und hielt es ungezieferfrei. Das Herdfeuer war
nicht nur zum Kochen und Wasser erwärmen, sondern es war die einzige
Heizung und zugleich das Licht im Haus.
Mit der "Allgemeinen Feuerordnung von 1791" wurden diese
feuergefährlichen Zustände verboten und der Bau von Kaminen
verlangt. Brannte ein Strohdach, so brannte gleich der ganze Ort
ab. Doch ein gut gemeintes Gesetz allein bewirkt nichts.
Neubauten gab es in dieser Kriegszeit bei uns nicht. In
die alten Holzblockhäuser mit Strohdach konnte schlecht ein Kamin
eingebaut werden. Noch 1886 gibt Franz Oswald in Oberschweinbach
19, als 57-jähriger Witwer bei seiner Wiederverheiratung
den Beruf "Strohdachdecker" an. Er war der letzte seines
Berufsstandes.
Im Gesetzblatt von 17.5.1818 wurden Kamine zwingend
vorgeschrieben und die Feuerbeschau durch Kaminkehrer und
Sachverständige genau geregelt. Verstöße wurden bestraft.
Ab 1818 gibt es einen längeren Schriftwechsel zwischen dem
Dachauer Landrichter und der Hofmarksverwaltung. Die
Dorfbewohner konnten nicht lesen. Das Gesetz musste ihnen nicht nur
vorgelesen, sondern auch noch erklärt werden. Nur: Kamine
entstanden dadurch nicht von selbst. Der Landrichter drohte dem
Hofmarksverwalter Strafe an, wenn er das Gesetz nicht
durchsetzt. Der Verwalter wand sich. Überwiegend wären die
Kamine in Ordnung. Der Landrichter wollte einen genauen
Bericht .
Am 30.7.1823 waren bei 10 namentlich genannten Wohnungen die Kamine
schadhaft befunden. Es gab Anzeigen und Schriftwechsel.
1824 wurden noch drei arme alte Witwen, die nicht einmal ihren
Namen schreiben konnten, beanstandet. Deren Rauchabzug "ist
ausgebessert, trägt aber keinen neuen durch das ganze
Gebäude." Zwei Hausbesitzer bekamen eine Strafe und wollten im
Frühling 1825 einen neuen Kamin aufbauen.
1826 wurde versichert, dass es keine Beanstandungen mehr gab.
Ende der Hofmark Spielberg
1823 wurde aus der säkularisierten Klosterhofmark
Fürstenfeld das neue königliche Landgericht Bruck. Das Amt
Esting kam vom Landgericht Dachau zum neuen Landgericht Bruck,
ebenso die Hofmarken in diesem Gebiet. Bis 1848 wurden alle
Hofmarken aufgelöst und in die staatliche Verwaltung übernommen.
1833 enden die Briefprotokolle der Hofmark Spielberg. Die
Registratur kam in das Landgericht Bruck. Als sie dort nicht mehr
benötigt wurde, kamen die Bücher und Akten in das
Staatsarchiv München. Interessierte Heimatforscher können
die Protokolle im Staatsarchiv studieren. Der vorstehende
Aufsatz benützt die Briefprotokolle der Hofmark Spielberg
als Quelle. Alle Aussagen sind durch historische
Originalquellen belegt.